1. Vorbemerkungen
Soweit mir bekannt, gibt es bislang keine frei verfüg- und (nach)nutzbaren Geodaten des antiken Pompeji. Zweifelsfrei sind solche Daten vorhanden. Sicherlich besitzt etwa die Grabungsleitung von Pompeji solche Daten, und auf der Seite https://open.pompeiisites.org/ ist eine digitale Karte von Pompeji zugänglich. Obwohl die URL anderes erwarten lässt, ist es nicht möglich, die zugrunde liegenden Geodaten herunterzuladen und zu eigenen Zwecken weiter zu verwenden. Eine entsprechende Anfrage beim Urheber blieb unbeantwortet. Auch die an der University of Massachusetts Amherst von Eric Poehler entwickelte digitale Kartierung von Pompeji (s. Poehler 2017) bietet (soweit das ersichtlich ist) keine Möglichkeit des uneingeschränkten, vollständigen Downloads der zugrundeliegenden Geodaten.1 Elektronische, nicht-georeferenzierte Karten von Pompeji gibt es zuhauf – von Übersichts- bis hin zu Detailkarten. In den allermeisten Fällen handelt es sich dann aber um reine Bilddateien ohne eingebettete Geokoordinaten, deren Nachnutzung in verändertem Kontext nur sehr eingeschränkt möglich ist.
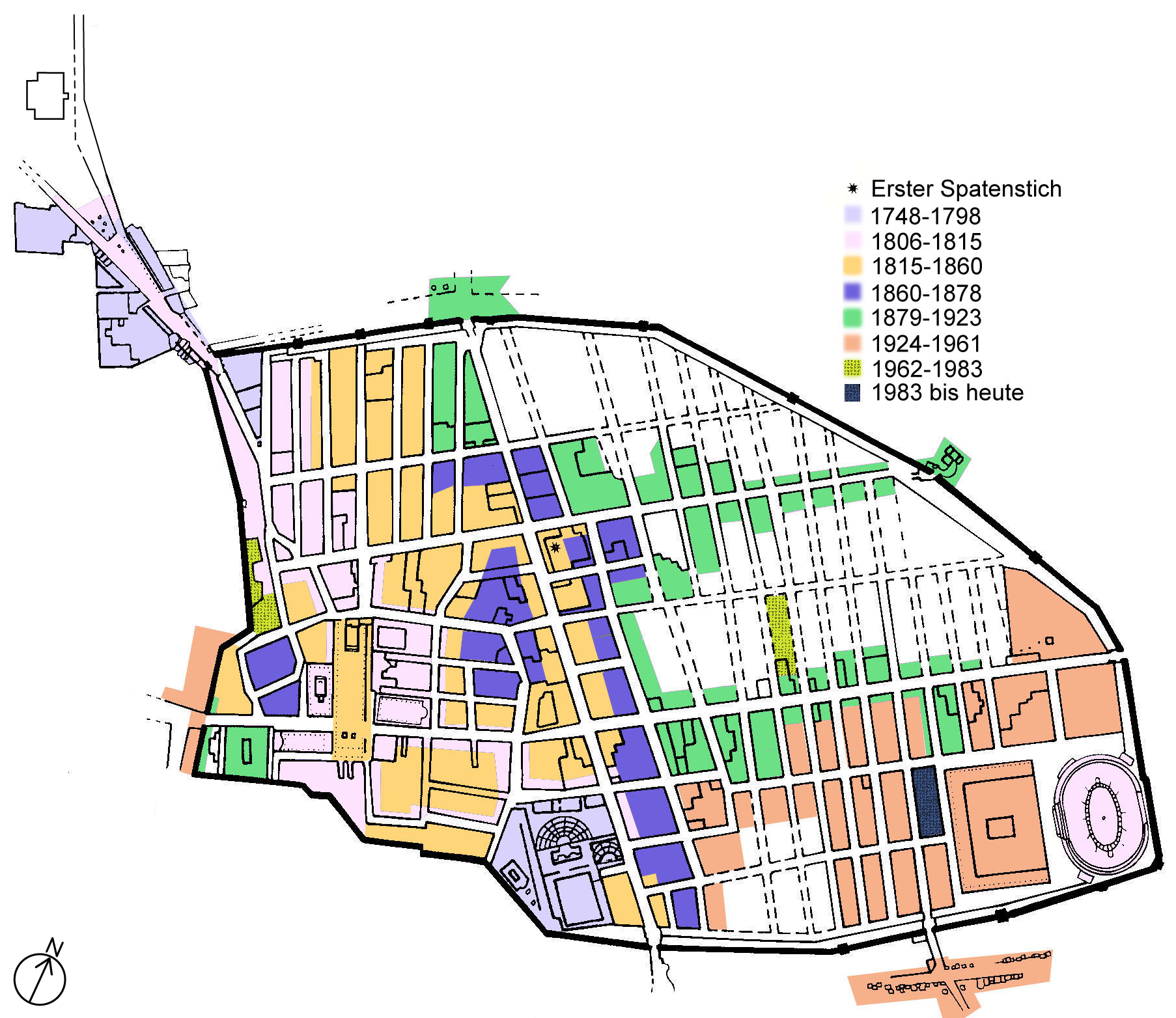
Beispiel für eine nicht-georeferenzierte elektronische Karte von Pompeji (Quelle: File:Timeline map of the excavations in Pompeii.png. (2022, January 14). Wikimedia Commons. Retrieved 15:39, January 12, 2025 from https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Timeline_map_of_the_excavations_in_Pompeii.png&oldid=621533609; CC BY-SA 3.0 Christoph Scholz)
Um dieser Problematik Abhilfe zu schaffen, wurde an der IT-Gruppe Geisteswissenschaften (ITG) der LMU damit begonnen, eine Sammlung georeferenzierter Daten des antiken Pompeji anzulegen. Bei diesen Daten handelt es sich im Wesentlichen um Vektordaten. Die Georeferenzierung erfolgte weitestgehend mit dem kostenfreien Open Source Programm QGIS. Zur Speicherung und Verarbeitung der Daten wurde das Datenbankmanagementsystem MariaDB (Version 10.6.18-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1, hinsichtlich Funktionalität MySQL 5.7 entsprechend) verwendet.
Grundlage für die Georeferenzierung bildete der Plan von Hans Eschebach (Eschebach 1993; posthum von Liselotte Eschebach herausgegeben, mit Ergänzungen von Jürgen Müller-Trollius). Dieser Plan (Maße: 90 cm x 170 cm) wurde mit einem Rollenscanner digitalisiert und das Digitalisat anschließend mit Hilfe des Programm QGIS georeferenziert. Der Scan des Originalplans kann aus urheberrechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden.
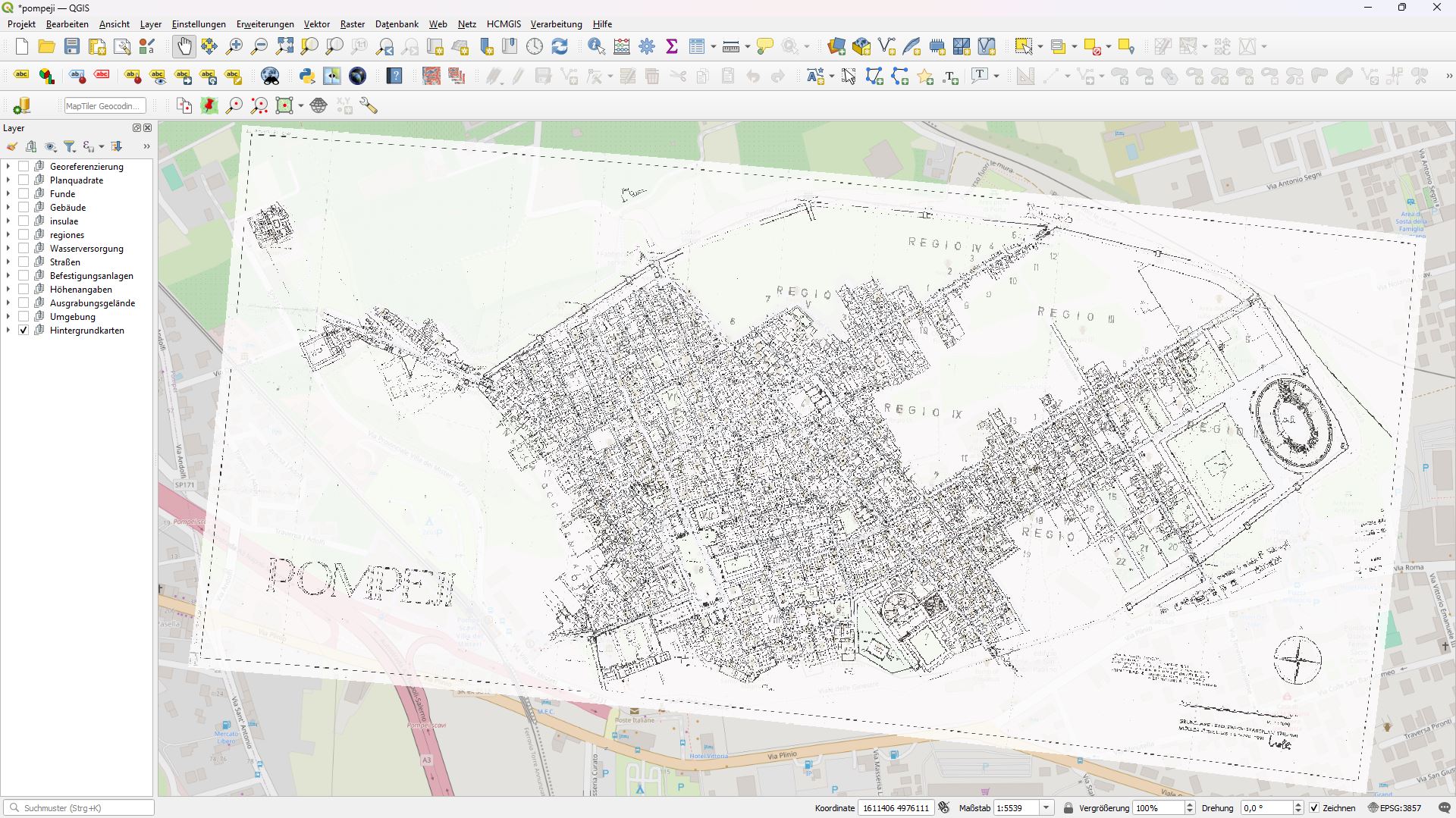
Georeferenzierte Karte von Eschebach im Programm QGIS. Im Hintergrund die Karte von OpenStreetmap. Es ist unklar, worauf die Abweichung der Nordausrichtung zurückzuführen ist (Einmessung mit Kompass und Auswirkung der magnetischen Missweisung?).
Für die Georeferenzierung der Eschebach-Karte und die darauf aufbauende Georeferenzierung der erschlossenen Entitäten wurde zunächst das Koordinatenbezugssystem (KBS) UTM zone 33N (= EPSG 32633) verwendet. Während der Arbeit zeigte sich, dass eine Umstellung auf das weit verbreitete KBS WGS 84 (= EPSG 4326) überwiegend Vorteile hat.2 Eine Umrechnung der Projektdaten in praktisch beliebige andere KBS (z. B. das für Italien maßgebende Monte Mario System [= EPSG 3003 und 3004]) ist problemlos möglich. Eine entsprechende Prozedur ist erfolgreich getestet worden.3
Erschlossen wurden hauptsächlich Daten, die georeferenziert werden können. Grundlegend ist die für die Ausgrabung von Pompeji in der archäologischen Literatur etablierte Systematik, die das Stadtgebiet von Pompeji in Regiones und Insulae einteilt und eine auf die Insulae bezogene Nummerierung der Hauseingänge verwendet. Als primäre Referenz bei der Erschließung diente die Publikation von Eschebach, die dem beschriebenen System folgt.
Sämtliche Geokoordinaten, seien es Punkte, Linien oder Flächen, wurden im sog. "Well Known Text"-Format (WKT) erfasst. Die Umrechnung in das von vielen GIS-Programmen und ‑Funktionen zur Durchführung von Rechenoperationen benötigte "Well Known Binary"‑Format (WKB) erfolgte mit der MySQL-Funktion ST_GeomFromText(wkt [, srid]), die zur Bibliothek der MySQL-Spatial-Funktionen gehört.
| Polygon ((14.486398347046068 40.74978621264031, 14.486517963100493 40.749602203437405, 14.486520805198333 40.74959428450131, 14.486531340023108 40.74958058329708, 14.486592515937115 40.74949149297035, 14.486137309877439 40.7493736660735, 14.48612133089498 40.74937200861298, 14.485954747224465 40.7496959328197, 14.485958227659552 40.749695419549106, 14.486398347046068 40.74978621264031)) |
Geokoordinaten der Insula VII 13 im WKT-Format (EPSG: 4326)
2. Erschließung des Datenmaterials
Grundlegend für die Erschließung des Datenmaterials ist die Definition der Datenstruktur. Diese orientiert sich zum einen am zu erschließenden Gegenstand und zum anderen an dessen individueller Wahrnehmung und dem mit der Erschließung verbundenen Zweck. Ein gewisses Maß an intuitiver Beeinflussung ist dabei unvermeidbar.
Die hier zur Verfügung gestellten Daten sollen möglichst universell nutzbar sein. Es liegt nahe, sich primär an den Entitätskategorien zu orientieren, die sich bei der mittlerweile jahrhundertelangen Beforschung von Pompeji fest etabliert haben. Entsprechend wurden die folgenden Kernentitäten definiert. Die Daten einer jeder dieser Entitäten sind in jeweils eigenen Tabellen abgelegt. Die Namen der Tabellenfelder sowie die Datentypen sind jeweils dem Create-Code zu entnehmen, der der Tabellenbeschreibung vorangestellt sind.
- Gebäude
- Eingänge
- Räume
- Regionen
- Insulae
- Straßen
- Stadttore
- Brunnen
- Wassertürme
- Gärten
- Stadtmauern
- Fundobjekte
- Höhen über NN
- Grabungs- und Fundflächen
Als weitere, periphere Entitäten wurden festgelegt:
- Ortschaften in der weiteren Umgebung von Pompeji
- Wasserversorgung
- Natürliche Gewässer
- Planquadrate (Quadratisches, georeferenziertes Gitternetz mit Kantenlängen 25 m, 50 m und 100 m)
- Quadranten (Einteilung des Stadtgebiets in vier Viertel gemäß antiker Systematik)
2.1. Die weitere Umgebung von Pompeji
Tabellen: `orte`; `wasserversorgung`; `pompeji`; `meer`
Zur weiteren Umgebung von Pompeji zählen vor allem die Nachbarstädte Herculaneum, Capua, Nola, Sarno, Nocera und Stabiae, nach denen heutzutage einige der Stadttore von Pompeji benannt sind. Die Geokoordinaten dieser Städte wurden erfasst, der Verlauf der Aqua Augusta (auch "Serino-Aquaeduct") wurde auf Basis einer einschlägigen Karte georeferenziert und die Daten in der Tabelle `Wasserversorgung` abgespeichert. Die Geodaten des Flusslaufs des Sarno wurden von OpenStreetMap übernommen.4 Der Verlauf der Küstenlinie stammt von einem Shapefile der Europäischen Umweltagentur.5 Einen guten Eindruck von der Topographie rund um den Golf von Neapel vermittelt das digitale Geländemodell von Italien, das in QGIS als Hintergrundlayer eingebunden werden kann.6
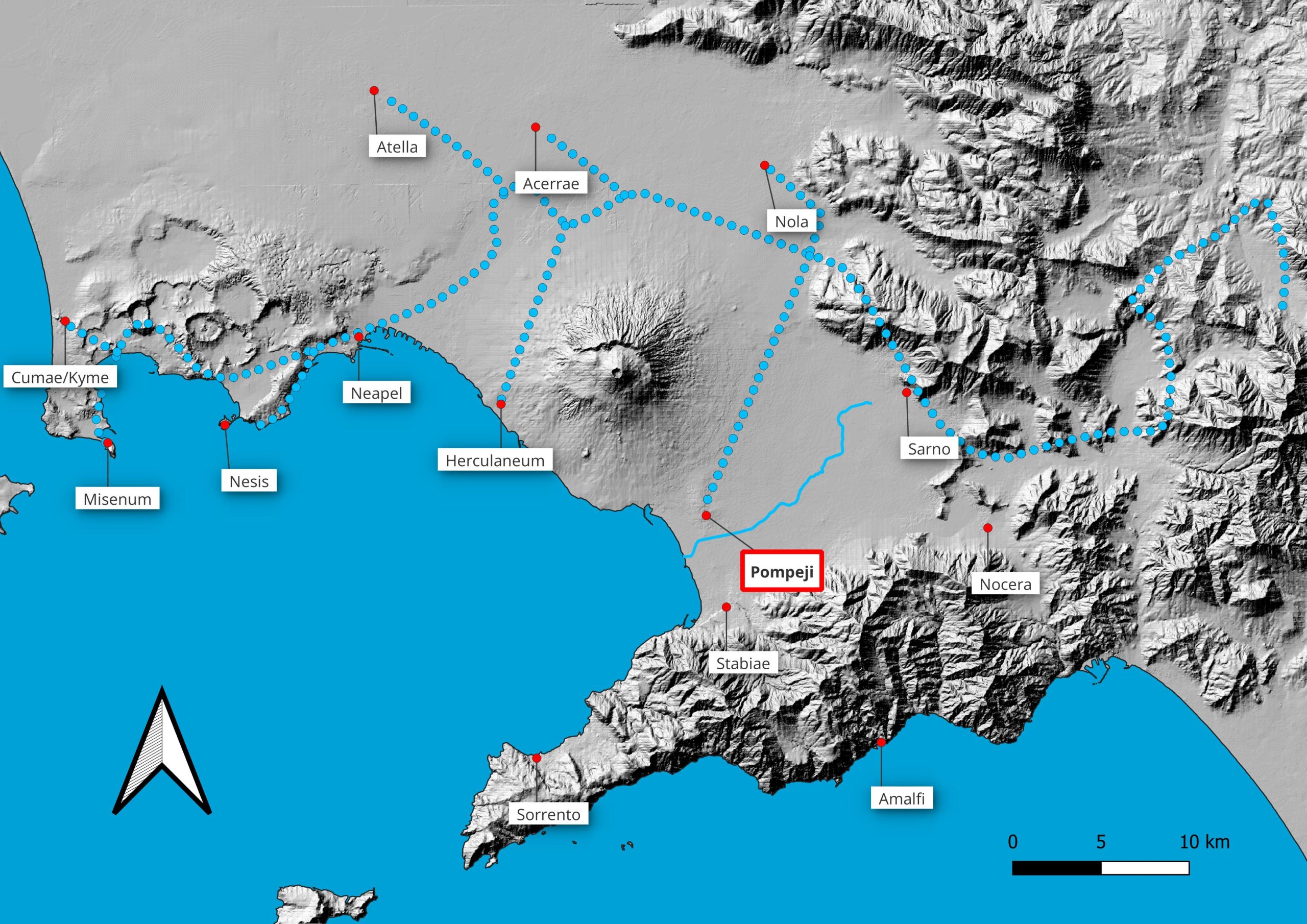
Karte des digitalen Geländemodells (Auflösung 20m) des Golfs von Neapel (Quelle: http://portalesgi.isprambiente.it/lista-servizi-wms/Geological%20Maps, CC BY 3.0). Links oben die phlegräischen Felder, im Zentrum der Vesuv. Die blaue gepunktete Linie markiert den Verlauf der Aqua Augusta und ihrer Seitenäste. Die Ebene östlich von Pompeji wird vom Fluss Sarno durchflossen. Das Geländemodell lässt erkennen, dass Pompeji auf einer kleinen Anhöhe (anscheinend ein Lavarücken aus prähistorischer Zeit) über der Sarnoebene liegt.
2.2. Befestigungsanlagen
Tabellen: `murus`; `turres`; `portae`
Erfasst wurden die insgesamt acht Stadttore und zwölf Türme. Der Mauerverlauf ist in einzelne Abschnitte unterteilt, für die jeweils angegeben ist, ob der entsprechende Abschnitt noch zumindest in Resten erhalten oder nur vermutet ist. Vermerkt ist ferner, ob es sich um eine Doppel- oder nur um eine einfache Mauer handelt. Im dem Meer zugewandten Westen und Südwesten der Stadt ist keine Stadtmauer vorhanden. In diesem Bereich sind die Fortifikationen bereits in der Antike teils durch luxuriöse Wohnbauten überbaut worden. Im Südwesten des Stadtgebiets liegt der älteste Teil von Pompeji, der nach Süden hin durch das dort steil abfallende Terrain geschützt ist, so dass hier keine Mauern erforderlich gewesen sind.
[polygonGroup load="pompeji_stadtgebiet"]
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 14); Länge: 28 Meter
Doppelmauer (ID: 15); Länge: 357 Meter
Doppelmauer (ID: 16); Länge: 65 Meter
Doppelmauer (ID: 17); Länge: 121 Meter
Doppelmauer (ID: 18); Länge: 104 Meter
Doppelmauer (ID: 19); Länge: 62 Meter
Doppelmauer (ID: 20); Länge: 35 Meter
Doppelmauer (ID: 21); Länge: 24 Meter
Doppelmauer (ID: 22); Länge: 38 Meter
Doppelmauer (ID: 23); Länge: 31 Meter
Doppelmauer (ID: 24); Länge: 6 Meter
Doppelmauer (ID: 25); Länge: 24 Meter
Doppelmauer (ID: 26); Länge: 74 Meter
Doppelmauer (ID: 27); Länge: 122 Meter
Doppelmauer (ID: 28); Länge: 240 Meter
Doppelmauer (ID: 29); Länge: 98 Meter
Doppelmauer (ID: 30); Länge: 20 Meter
Doppelmauer (ID: 31); Länge: 9 Meter
Doppelmauer (ID: 32); Länge: 6 Meter
Doppelmauer (ID: 33); Länge: 587 Meter
Doppelmauer (ID: 34); Länge: 146 Meter
Doppelmauer (ID: 35); Länge: 169 Meter
Doppelmauer (ID: 36); Länge: 54 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 37); Länge: 34 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 38); Länge: 55 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 39); Länge: 31 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 40); Länge: 28 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 41); Länge: 103 Meter
Turm I
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm II
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm III
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm IV
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm V
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm VI
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm VII
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm VIII
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm IX
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm X
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm XI
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm XII
Externe Links
PIP
Kommentar
Stadtmauer, Stadttore und Mauertürme von Pompeji. Die vier Haupttore an den Enden von Decumanus maximus und Cardo maximus sind durch rote Kreise markiert. Mauerabschnitte, von denen keine Reste erhalten sind, sind durch gestrichelte Linien wiedergegeben.
2.3. Bebauungsphasen
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Stadtgrenze
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter
Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter
Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter
Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter
Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter
Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter
Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter
Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter
Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter
Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter
Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter
Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter
Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter
Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter
Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter
Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter
Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter
Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter
Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter
Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter
Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter
Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter
Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter
Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter
Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter
Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter
Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter
Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter
Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter
Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter
Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter
Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter
Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter
Die Bebauungsphasen von Pompeji. Rot: Siedlungskern; blau: Erste Erweiterung; grün: zweite Erweiterung; gelb: dritte Erweiterung (gemäß Wikipedia 2024)
2.4. Straßennetz
Tabellen: `viae`
Der Stadtplan von Pompeji wurde nicht, wie das z. B. bei römischen Militärlagern der Fall war, auf dem Reißbrett entworfen, vielmehr entwickelte sich das Stadtgebiet phasenweise nach und nach. Berücksichtigt man den Zusammenhang zwischen Straßenverläufen und Stadttoren, so ergibt sich eine einigermaßen klare Hierarchie. Es lassen sich Straßenverläufe feststellen, die (1) an beiden Enden jeweils auf ein Stadttor treffen, ferner solche, bei denen dies (2) nur an einem Ende der Fall ist, und schließlich solche, die (3) gar nicht mit einem Stadttor verbunden sind. Von der Kategorie (1) existieren genau zwei Straßenzüge, die sich im Bereich des Aufeinandertreffens der Regiones I, IX, VII und VIII in nahezu rechtem Winkel schneiden.
Die Straßen von Pompeji werden üblicherweise mit modernen Namen bezeichnet. Antike Namen sind nicht bekannt. Durch die moderne Namensgebung ergibt sich bisweilen eine Unterteilung längerer Straßenzüge in kürzere Abschnitte, die ziemlich sicher nicht der antiken Wahrnehmung entsprechen. Am deutlichsten ist dies im Fall der beiden Hauptachsen des Straßensystems, die die Stadt von Ost nach West bzw. von Nord nach Süd durchziehen und die heute gerne "Decumanus maximus" (Ost-West) bzw. "Cardo maximus" (Nord-Süd) genannt werden. Ob diese Straßenzüge auch in der Antike als "decumanus" bzw. "cardo maximus" bezeichnet oder auch nur als solche wahrgenommen worden sind, ist nicht bekannt. Zumindest im Fall des sog. "Cardo maximus" handelt es sich jedoch um einen ununterbrochenen Straßenzug, der die Porta del Vesuvio im Norden mit der Porta di Stabia im Süden verbindet. Heute trägt dieser Straßenzug im nördlichen und im südlichen Teil unterschiedliche Namen. Man darf bezweifeln, dass das auch in der Antike so gewesen ist.
Die Thematik ist deswegen relevant, da sie die Problematik der Berechnung der durchschnittlichen Länge der Straßen berührt.
Die Erschließung des Straßensystems erfolgte zunächst auf Basis der modernen Bezeichnungen. Für die Berechnung z. B. der Länge des Cardo Maximus musste daher zunächst die Länge der Via del Vesuvio und die der Via Stabiana adiert werden. Es liegt nahe, das Straßensystem von Pompeji aus der Systematik der modernen Benennungen herauszulösen und stattdessen eine Ordnung anzuwenden, die sich organisch daraus ergibt, ob Straßenverläufe durch Einmündungen in quer verlaufende Straßen oder das Treffen auf die Stadtmauer unterbrochen werden oder nicht.
[polygonGroup load="pompeji_stadtgebiet"]
Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter
Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter
Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter
Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter
Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter
Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter
Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter
Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter
Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter
Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter
Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter
Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter
Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter
Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter
Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter
Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter
Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter
Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter
Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter
Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter
Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter
Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter
Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter
Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter
Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter
Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter
Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter
Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter
Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter
Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter
Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter
Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter
Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter
Stadtgrenze
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
Das Straßennetz von Pompeji. Ausgegrabene Straßenzüge sind mit durchgezogenen Linien wiedergegeben, gestrichelte Linien stehen für noch nicht ausgegrabene und vermutete Straßenverläufe. Die Dicke der Linien orientiert sich an der vermuteten Bedeutung der Straßen. Straßen, die an beiden Enden auf ein Stadttor treffen, sind als am bedeutendsten aufgefasst. Die zweite Kategorie wird von Straßen gebildet, die nur an einem Ende auf ein Stadttor treffen. Alle anderen Straßen bilden eine dritte Kategorie. Durch Ausgrabung nachgewiesene Straßenverläufe sind als durchgezogene, vermutete durch gestrichelte Linien dargestellt.
Die für uns gewohnte Nord-Süd-Ausrichtung einer Karte entspricht nicht der römischen Sichtweise. Für die Römer ist stets, dem Lauf der Sonne folgend, die Ost-West-Achse prävalent gewesen, wobei die Blickrichtung durchaus unterschiedlich sein konnte. Der besterhaltene der bekannten Katasterpläne von Orange (Katasterplan B), der die Neuvermessung von Land zur Verteilung an Veteranen dokumentiert, blickt nach Westen (Westen ist auf dem Plan oben). Die Bezeichnungen "mare superum" für die Adria und "mare inferum" für das Tyrrhenische Meer zeigen hingegen eine Blickrichtung nach Osten an. Dem entspricht auch die Darstellung Italiens auf der Tabula Peutingeriana.7
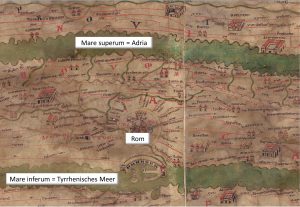
Ausschnitt aus der Tabula Peutingeriana. Die Karte ist "geostet", d. h. Osten befindet sich oben. Die von links nach rechts verlaufende Landmasse in der Mitte des Bildes ist Italien, oberhalb davon ist die Adria dargestellt, unterhalb das Tyrrhenische Meer.
Grundsätzlich ist beides für Pompeji vorstellbar, sowohl die Wahrnehmung der Stadt mit Blick nach Westen wie auch nach Osten. Die Stadterweiterung nach Osten hin legt allerdings die Vermutung nahe, dass man, den ältesten Stadtkern im Bereich der Regiones VII und VIII im Rücken, die Blickrichtung nach Osten eingenommen hat. Ausgehend davon hätten sich dann, der römischen Systematik der Limitation entsprechend, die folgenden vier Quadranten ergeben:8
Stadtgebiet (Fläche: 63 Hektar)
Stadtgrenze
Sinistra Decumanum, Ultra Cardinem (SD VK)
Dextra Decumanum, Ultra Cardinem (DD VK)
Dextra Decumanum, Citra Cardinem (DD KK)
Sinistra Decumanum, Citra Cardinem (SD KK)
[polygonGroup load="pompeji_nordpfeil"]
Fiktive Einteilung des Stadtgebiets von Pompeji in römischer Perspektive
2.5. Eingänge und Gebäude
Tabellen: `eingaenge`, `gebaeude_eingaenge`
Garten zu Gebäude I 13, 9
Garten zu Gebäude I 13, 12.13.14
Garten zu Gebäude I 12, 9.14
Garten zu Gebäude I 12, 15
Garten zu Gebäude I 11, 10.11.12
Garten zu Gebäude VII 11, 1
Garten zu Gebäude II 1, 11.12.7a
Garten zu Gebäude II 1, 3.4.5.6.7
Garten zu Gebäude II 1, 10
Garten zu Gebäude II 2, 1.2.3.5.6
Garten zu Gebäude II 3, 4a.4.5.6
Garten zu Gebäude II 3, 7.8.9
Garten zu Gebäude II 4, 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12
Garten zu Gebäude VIII 3, 14.15
Garten zu Gebäude I 16, 2.a
Garten zu Gebäude I 15, 2.3.4.6
Garten zu Gebäude I 14, 4.5.10
Garten zu Gebäude I 14, 2
Garten zu Gebäude II 9, 5.6
Garten zu Gebäude II 9, 4
Garten zu Gebäude I 20, 5
Garten zu Gebäude I 20, 4
Garten zu Gebäude I 20, 1.2.3
Garten zu Gebäude II 8, 6
Garten zu Gebäude II 8, 4.5
Garten zu Gebäude II 8, 2.3
Garten zu Gebäude II 8, 1
Garten zu Gebäude I 21, 1
Garten zu Gebäude III 7, 6.7
Garten zu Gebäude VIII 6, 3
Garten zu Gebäude VIII 6, 6
Garten zu Gebäude I 22, 1.2.3
Garten zu Gebäude II 7, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
Garten zu Gebäude IX 13, 1.2.3
Garten zu Gebäude VIII 5, 36
Garten zu Gebäude II 5, 1.2.3.4
Garten zu Gebäude VI 1a, 12.15
Garten zu Gebäude VI 11, 5.15.16
Garten zu Gebäude VII 10, 3.14
Garten zu Gebäude VI 11, 3
Garten zu Gebäude VI 5, 7
Gebäude I 14, 2
(ID 1)
Fläche: 412 qm
Räume
-
Name(n)
Stalla
Kategorien
Atriumhaus; Garten; Stall
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: stabulum?;
Gebäude I 14, 3
(ID 2)
Fläche: 139 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Privathaus.;
Gebäude I 15, 1
(ID 7)
Fläche: 341 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Atriumhaus.;
Gebäude I 15, 2.3.4.6
(ID 8)
Fläche: 2245 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Nave Europa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa della Nave Europa mit Obstplantage, Obsthandel und Obstverkauf?;
Gebäude I 16, 1
(ID 9)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Scala
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Treppe zu einer Wohnung im OG.;
Gebäude I 16, 3
(ID 11)
Fläche: 112 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ärmliches kleines Handwerkerhaus.;
Gebäude I 16, 4
(ID 12)
Fläche: 362 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Poppaeus Charitonus (?)
Kategorien
Atriumhaus; Garten; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus mit Garten des Poppaeus Charitonus (?), noch nicht völlig ausgegraben.;
Gebäude I 17, 1
(ID 14)
Fläche: 241 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Atriumhaus, nur nördlicher Teil angegraben.;
Gebäude I 17, 4
(ID 16)
Fläche: 321 qm
Räume
-
Name(n)
Casa degli Archi; Casa della Maschera tragica
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa degli Archi. Casa della Maschera tragica. Haus eines Schauspielers? Hofhaus, im N und O nicht ausgegraben. Eingang mit Vordach.;
Gebäude I 18, 1
(ID 17)
Fläche: 33 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Fassade Kalkstein-inc. mit Kalksteinpfosten).;
Gebäude I 18, 2
(ID 18)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang (Fassade r. samn., l. n. Erdb.).;
Gebäude I 18, 3
(ID 19)
Fläche: 33 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt (Fassade n. Erdb.).;
Gebäude I 18, 4
(ID 20)
Fläche: 51 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt (Fassade n. Erdb.).;
Gebäude I 19, 3
(ID 22)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di L. Satrius Rufus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Satrius Rufus (angegraben).;
Gebäude I 19, 4
(ID 23)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Earinus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Earinus (angegraben).;
Gebäude I 19, 5
(ID 24)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Minio Carpo
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Minio Carpo.;
Gebäude I 19, 6
(ID 25)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang, Kalkstein-inc.;
Gebäude I 19, 7
(ID 26)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang, Kalkstein-inc.;
Gebäude I 19, 8
(ID 27)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden? Fassade Kalkstein op. quadr.;
Gebäude I 19, 9
(ID 28)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang, Fassade kalkstein op. quadr.;
Gebäude I 20, 4
(ID 31)
Fläche: 478 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Garten; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Obstgarten und einfachen Wohnungen.;
Gebäude I 20, 5
(ID 32)
Fläche: 728 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con vigna
Kategorien
Garten; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa con Vigna. Wohnung eines Weinproduzenten mit Weingarten. Vigna con cella vinaria e laboratorio.;
Gebäude I 21, 1
(ID 33)
Fläche: 2277 qm
Räume
-
Name(n)
L'Orto dei fuggiaschi
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: L'Orto dei fuggiaschi. Wohnhaus mit caupona.;
Gebäude I 21, 2
(ID 34)
Fläche: 148 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Eingeebnetes Trümmergrundstück: Baumschule mit triclinium.;
Gebäude II 1, 2
(ID 38)
Fläche: 162 qm
Räume
-
Name(n)
Casa degli Aemilii, Primus e Saturninus
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Aemilii, Primus und Saturninus, Vermieter der caupona des Hermes.;
Gebäude II 1, 10
(ID 41)
Fläche: 628 qm
Räume
-
Name(n)
Casa Imperiale
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa Imperiale.;
Gebäude II 1, 7a.11.12
(ID 42)
Fläche: 958 qm
Räume
-
Name(n)
Complesso dei Riti magici
Kategorien
Garten
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kultgarten und Bankettraum für Mysterien des Jupiter Sabazius mit Kapelle der Sybilla Pompeiana (Biria). Kultdiener Sextilius Pyrricus? Complesso dei Riti magici.;
Gebäude II 2, 1.2.3.5.6
(ID 44)
Fläche: 2399 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di D. Octavius Quartio; Casa di Laomedonte
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der M. Loreii Tiburtini mit Wohnung des T. Octavius Quartio im OG, caupona des Pardalus und popina des Athi(y)ctus und Astylus. Casa di Laomedonte.;
Gebäude II 2, 4
(ID 45)
Fläche: 367 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Augustale; Casa dell'Emblema Augusteo; Casa della della Corona Civica; Casa della Corona di Quercia; Casa di Messius Ampliatus, sacerdos Augusti
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Messius Ampliatus, sacerdos Augusti. Casa del Augustale, Casa dell' Emblema Augusteo, Casa della Corona di Quercia, della Corona Civica.;
Gebäude II 3, 1.2.3
(ID 46)
Fläche: 703 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Venere in conchiglia; Casa di Venere Marina; Haus der D. Lucretii Satrii Valentes
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der D. Lucretii Satrii Valentes, Casa della Venere in Conchiglia, di Venere Marina.;
Gebäude II 4, 1
(ID 50)
Fläche: 43 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Heiligtum, Altar; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des gemmarius Campanus und des caelator Priscus. R. vor dem Eingang ara compitalis.;
Gebäude II 6, 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11
(ID 54)
Fläche: 10541 qm
Räume
L1, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L2, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L3, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L4, L40, L5, L6, L7, L8, L9, M1, M10, M100, M101, M102, M103, M104, M105, M106, M107, M108, M109, M11, M110, M111, M112, M113, M114, M115, M116, M117, M118, M119, M12, M120, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M2, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M3, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M36, M37, M38, M39, M4, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M46, M47, M48, M49, M5, M50, M51, M52, M53, M54, M55, M56, M57, M58, M59, M6, M60, M61, M62, M63, M64, M65, M66, M67, M68, M69, M7, M70, M71, M72, M73, M74, M75, M76, M77, M78, M79, M8, M80, M81, M82, M83, M84, M85, M86, M87, M88, M89, M9, M90, M91, M92, M93, M94, M95, M96, M97, M98, M99
Name(n)
Anfiteatro
Kategorien
Theater
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: spectacula (Amphitheater) mit 10 Eingängen (5 ebenerdig zur Arena, 2 Treppenpaare und 2 Einzeltreppen zum OG).;
Gebäude II 8, 1
(ID 56)
Fläche: 530 qm
Räume
-
Name(n)
Ristorante con giardino
Kategorien
Garten; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Speisewirtschaft mit Garten.;
Gebäude II 8, 6
(ID 58)
Fläche: 1434 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Giardino di Ercole
Kategorien
Atriumhaus; Garten
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Reihenhaus mit Blumen- und Kräuterplantage, 'Garten des Hercules'. Blumen-, Parfüm- und Salbenherstellung aus Heilkräutern.;
Gebäude II 9, 1
(ID 59)
Fläche: 311 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Quietus (?) mit Gastwirtschaft?;
Gebäude II 9, 3
(ID 60)
Fläche: 105 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kalksteinhaus, mit verschlossener Tür (Ausguß), nur durch Mannsloch im Haus 4 zu erreichen (gemeinsamer hortus mit 4 und 5, gemeinsames OG mit 4?);
Gebäude II 9, 4
(ID 61)
Fläche: 126 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Larario fiorito
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Larario fiorito.;
Gebäude III 1, 1
(ID 62)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ladeneingang.;
Gebäude III 1, 2
(ID 63)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ladeneingang (?) Werkzeugverkauf (?) zu Haus 3?;
Gebäude III 1, 4
(ID 64)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Werkzeugverkauf?) (zu Haus 3?).;
Gebäude III 1, 5
(ID 65)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio di terracotta
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Terrakotta-Geschäft.;
Gebäude III 1, 6
(ID 66)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Casa o officina di Praedicinius
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus oder Werkstatt des Praedicinius.;
Gebäude III 2, 1a
(ID 67)
Fläche: 497 qm
Räume
-
Name(n)
Casa degli Scacchi; Haus des A. Trebius Valens
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des A. Trebius Valens; Casa degli Scacchi.;
Gebäude III 2, 2
(ID 68)
Fläche: 206 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Zum Haus 1 gehöriger Laden des Sotericus.;
Gebäude III 2, 3
(ID 69)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Officina di Lutatius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt und Wohnung der Lutati (?).;
Gebäude III 3, 1
(ID 70)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Officina e bottega del veteramentarius Tigillus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt und Laden des veterarius (veteramentarius) Tigillus.;
Gebäude III 4, 2.3
(ID 73)
Fläche: 639 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Moralista; Casa di C. Arrius Crescens, T. Arrius Polites, M. Arrius Polites
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Doppelhaus des C. Arrius Crescens, T. Arrius Polites, M. Arrius Polices, Arrius Stephanus und M. Epidius Hymenaeus (Weinhändler); Casa del Moralista. Doppelhaus mit gemeinsamem atrium testud.;
Gebäude III 4, b
(ID 74)
Fläche: 254 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dell'orefice; Casa di Ifigenia; Casa di Pinarius Cerialis
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Pinarius Cerialis und der Cassia. Haus eines faber gemmarius, caelator und Hercules-Priesters. Casa del l'orefice, Casa di lfigenia.;
Gebäude III 4, e
(ID 76)
Fläche: 243 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Sodala; Haus des (der) Sodala
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des (der) Sodala.;
Gebäude III 4, f
(ID 77)
Fläche: 355 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Sucessus Pucta
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Successus Pucta oder des Martialis.;
Gebäude III 5, 1
(ID 78)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Taberna e Casa di Pascius Hermes
Kategorien
Handel und Gewerbe; Lebensmittel; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft (?) des Pascius Hermes, im OG vermietbare cenacula (Werkstätten).;
Gebäude III 5, 2
(ID 79)
Fläche: 45 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Loreii
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Loreii.;
Gebäude III 5, 4
(ID 80)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
N/A
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang. Nicht ausgegraben. Kalksteinportal mit kubischen Kapitellen, Mauern Lava-inc.;
Gebäude III 5, 5
(ID 81)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona (?), Ladeneingang, nicht ausgegraben.;
Gebäude III 6, 4
(ID 83)
Fläche: 28 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di M. Satrius (?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Satrius? Hauseingang mit Nebenräumen. Angegraben.;
Gebäude III 6, 5
(ID 84)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona di C. Sabinius Statio
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona Statii, des C. Sabinius Statio.;
Gebäude III 6, 6
(ID 85)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden? Nichts erkennbar, modern vermauert.;
Gebäude III 7, 1
(ID 86)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden?;
Gebäude III 7, 2
(ID 87)
Fläche: 49 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Popidius Metellicus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Popidius Metellicus. Baustoffhändler?;
Gebäude III 7, 3
(ID 88)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden?;
Gebäude III 7, 4
(ID 89)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Stalla
Kategorien
Stall
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: stabulum mit Einfahrt und Rampe.;
Gebäude III 8, 3.4.5
(ID 92)
Fläche: 80 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Perseo bambino; Haus des Lucius und der Animula; House of Danae and Perseus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Lucius und der Animula; Vendemmia; Decuria Cotini; Casa di Perseo bambino. House of Danae and Perseus.;
Gebäude III 8, 5
(ID 93)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
N/A
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG (?) mit Nebeneingang zu 4?;
Gebäude III 8, 8.9
(ID 95)
Fläche: 43 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Pelorus con caupona di Astylus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Pelorus mit caupona des Astylus.;
Gebäude III 9, 1
(ID 96)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt zu 2 (?). In der Rückwand zugemauerte Tür. ;
Gebäude III 9, 2
(ID 97)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Casa sannitica
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Samn. Haus.;
Gebäude III 9, 3
(ID 98)
Fläche: 28 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Breiter Eingang (vorgesetzte Fassade), verbunden mit 3?;
Gebäude III 9, 5
(ID 99)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Officina? Caupona?
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt? caupona?;
Gebäude III 9, 6
(ID 100)
Fläche: 68 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ladentür.;
Gebäude III 10, 6
(ID 103)
Fläche: 97 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium.;
Gebäude III 11, a.1
(ID 104)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona?
Kategorien
caupona; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona ?;
Gebäude IV 1, 1
(ID 110)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt. Nicht erkennbar, nicht ausgegraben.;
Gebäude IV 1, 2
(ID 111)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt (zu 1?). Nicht erkennbar, nicht ausgegraben.;
Gebäude IV 1, 3
(ID 112)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
N/A
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Nebeneingang zu 2 (?). Nicht erkennbar, nicht ausgegraben. ;
Gebäude IV 1, 4
(ID 113)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
N/A
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: fauces, ambitus oder Treppe zum OG? Nicht erkennbar, nicht ausgegraben. ;
Gebäude IV 1, 5
(ID 114)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Neues Grundstück (Rücksprung der Fassade). Laden (zu 6?).;
Gebäude IV 2, 1
(ID 116)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona o officina
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona oder Werkstatt (zu 2?).;
Gebäude IV 2, 2
(ID 117)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Pilastri colorati
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa dei Pilastri colorati.;
Gebäude IV 2, 3
(ID 118)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (?) zu 4? Im Bürgersteig Kanal mit Auslauf zur Straße.;
Gebäude IV 2, 4
(ID 119)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di un produttore di vino?
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Weinproduzenten? Vendemmia, Kelterei? Fassadenbild: Kelternde Satyrn.;
Gebäude IV 3, 4
(ID 122)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Officina?
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Nebeneingang zu 3 (?). Werkstatt?;
Gebäude IV 3, 5
(ID 123)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Iphigenia (?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Iphigenia (?).;
Gebäude IV 3, 6
(ID 124)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Plaustra (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Plaustra (?) mit Nebenraum, mit Verbindung zu 7?;
Gebäude IV 3, 7
(ID 125)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di M. Cerrinius Vatia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und Grundstück des M. Cerrinius Vatia (?), patronus mulionum, verbunden mit 8.9?;
Gebäude IV 4, 1
(ID 127)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden. Zugehörigkeit zu 2 nicht erwiesen.;
Gebäude IV 4, 2
(ID 128)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
N/A
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang.;
Gebäude IV 4, 3
(ID 129)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IV 5, 4
(ID 132)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
N/A
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Überdachter Hof (?) mit Fe., zu 3 gehörig?;
Gebäude V 1, 2
(ID 134)
Fläche: 42 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona di Fortunatus?
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona des Fortunatus?;
Gebäude V 1, 4
(ID 136)
Fläche: 36 qm
Räume
-
Name(n)
Infectorium
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: infectorium. Färberei und Wäscherei für neue Wolle.;
Gebäude V 1, 5
(ID 137)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Infectorium
Kategorien
fullonica
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: infectorium, im OG mit 4 verbunden?;
Gebäude V 1, 6
(ID 138)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden zu 7;
Gebäude V 1, 8
(ID 139)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit r. hinten Treppe zum HG.;
Gebäude V 1, 13
(ID 143)
Fläche: 119 qm
Räume
-
Name(n)
Popina di Salvius
Kategorien
Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina des Salvius und Werkstatt (Verkauf von Bronzewaren?) mit Wohnung im OG.;
Gebäude V 1, 17
(ID 145)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?); Statio degli Aliarii
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Statio degli Aliarii (Würfelspieler oder Knoblauchgärtner?), Bronzeladen?;
Gebäude V 1, 19
(ID 147)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude V 1, 22
(ID 149)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Eisenwaren?).;
Gebäude V 1, 10.23.25.26.27
(ID 150)
Fläche: 984 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Banchiere; Casa del Notaio; Casa di Ifigenia; Casa di L. Caecilius Iucundus; Haus des L. Caecilius lucundus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Caecilius lucundus, argentarius oder coactor argentarius und der Rustica? Casa del Notaio; Casa del Banchiere; Casa di Ifigenia; Wohnung des Faustus.;
Gebäude V 1, 28
(ID 151)
Fläche: 90 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di C. Cassius Bassus (?)
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Handwerkerhaus des C. Cassius Bassus (?), zuletzt des M. Tofelanus Valens (Juwelier?).;
Gebäude V 1, 29
(ID 152)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des M. Tofelanus Valens, vermietet an Auxilio. R. Treppe zum HG, keine Einbauten erhalten.;
Gebäude V 1, 30
(ID 153)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega; Laden des Canices
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Canices mit Magazin und Wohnung.;
Gebäude V 1, 31
(ID 154)
Fläche: 35 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Flüssigkeiten).;
Gebäude V 2, a'.a.1
(ID 156)
Fläche: 419 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Regina Margherita; Domus of Alfius, or Sallustius, Capito and Calventiacypare; Haus des Capito
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Capito; Domus of Alfius, or Sallustius, Capito and Calventiacypare; Casa della Regina Margherita.;
Gebäude V 2, 2
(ID 157)
Fläche: 35 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung.;
Gebäude V 2, 3
(ID 158)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona mit Hinterzimmer und Wohnung.;
Gebäude V 2, 4
(ID 159)
Fläche: 431 qm
Räume
-
Name(n)
Auberge de Crescens; Casa del Simposio; Casa del Triclinio; Casa di Bacco
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Triclinio; Casa del Simposio; Casa di Bacco II; u. a. Treffpunkt der fullones; Auberge de Crescens; diversorium, caupona mit vermietbaren Zimmern im OG.;
Gebäude V 2, 5
(ID 160)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit lararium, Treppe zum OG an der Rückwand und Fe. zu Laden 6. R. Podium oder Herd.;
Gebäude V 2, 6
(ID 161)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Retrobottega.;
Gebäude V 2, 7
(ID 162)
Fläche: 423 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con stalle
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Privathaus mit Ställen.;
Gebäude V 2, 8
(ID 163)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkzeug-Laden (?) mit Magazin.;
Gebäude V 2, 9
(ID 164)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung im OG.;
Gebäude V 2, 12
(ID 166)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung.;
Gebäude V 2, 13
(ID 167)
Fläche: 43 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Simposio II
Kategorien
Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; Latrinen; thermopolium; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina, thermopolium mit Wohnung; Casa del Simposio II. Großer Ladenraum, r. zweischenkeliges Podium mit 4 Urnen und Herd, davor 2 Stufen, hinten r. Gaststube. L. Treppe zum OG und Gang zur Küche mit Herd und Latrine.;
Gebäude V 2, 14
(ID 168)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina (?), Laden (?) mit Hinterzimmer und Wohnung.;
Gebäude V 2, 21
(ID 170)
Fläche: 526 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Adone; Haus des Adonis
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Angegraben: Wirtschaftsgebäude mit posticum zu i? Handwerkerhaus? Schmiede?; PIP: Vollständig ausgegraben 2018. Name nunmehr "Casa di Adone" (Haus des Adonis); https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R5/5%2002%2021.htmSLuecke: Vollständig ausgegraben 2018. Name nunmehr "Casa di Adone" (Haus des Adonis);
Gebäude V 2, d
(ID 173)
Fläche: 230 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Reihenhaus;
Gebäude V 2, e
(ID 174)
Fläche: 163 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Nebenhaus zu i: caupona mit Fund dreier Blasinstrumente (tubae) von Gladiatoren.;
Gebäude V 2, f
(ID 175)
Fläche: 174 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Musa, procuratore di N. Herrennius Castus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus des Musa, procurator des N. Herrennius Castus.;
Gebäude V 2, g
(ID 176)
Fläche: 460 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di N. Fufidius Successus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des N. Fufidius Successus, Weinproduzent, Besitzer der caupona in I 8, 15.16;
Gebäude V 2, h
(ID 177)
Fläche: 277 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Cenacolo; Casa del Larario col dipinto d'Ercole; Haus (der Aufidia Successa?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Aufidia Successa? Casa del Cenacolo; Casa del Larario col dipinto d'Ercole.;
Gebäude V 2, e.i.21
(ID 178)
Fläche: 1762 qm
Räume
-
Name(n)
Casa delle Nozze d'argento; Domus des L. Albucius Celsus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus des L. Albucius Celsus; Casa delle Nozze d'argento. ln der exedra des Peristyls Schule des Helenus. ; Strocka 2004: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa delle Nozze d'argento (V 2,i) [2004];
Gebäude V 3, 5
(ID 181)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden;
Gebäude V 3, 6
(ID 182)
Fläche: 97 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Narcisso; Casa di Narkisso; Haus der Ceia L. F. Helpia
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Ceia L. F. Helpia; Casa di Narkissos, Casa di Narcisso. caupona? ;
Gebäude V 3, 7
(ID 183)
Fläche: 175 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del grande Larario; Casa della Regina d'Olanda; Haus des Tiberius Claudius Verus?
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Tiberius Claudius Verus? Casa della Regina d'Olanda; Casa del grande Larario.;
Gebäude V 3, 8
(ID 184)
Fläche: 343 qm
Räume
-
Name(n)
Panificio
Kategorien
Atriumhaus; Bäckerei
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Bäckerei.;
Gebäude V 3, 9
(ID 185)
Fläche: 75 qm
Räume
-
Name(n)
Haus des Cosmus und der Epidia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus des Cosmus und der Epidia.;
Gebäude V 3, 10
(ID 186)
Fläche: 207 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con atrio con fabbrica di tessitura
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Atriumhaus mit Weberei, Spinnerei.;
Gebäude V 3, 11
(ID 187)
Fläche: 233 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Privathaus eines Juweliers (Werkstatt im OG?).;
Gebäude V 3, 12
(ID 188)
Fläche: 197 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Duchessa di Aosta; Haus des M. Samellius Modestus?
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Samellius Modestus? Casa della Duchessa di Aosta; Großhandel mit Haushaltswaren?;
Gebäude V 4, 3
(ID 190)
Fläche: 283 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di un Flamine
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa di un Flamine.;
Gebäude V 4, 4
(ID 191)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Einbauten mit Larennische an der Rückwand.;
Gebäude V 4, 5
(ID 192)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Garum oder Weinausschank?);
Gebäude V 4, 6.7.8
(ID 193)
Fläche: 159 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona di Spatalus; caupona und thermopolium des Spatalus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona und thermopolium des Spatalus, servus des Cornelius Zosimus, mit cella vinaria und hospitium.;
Gebäude V 4, 9
(ID 194)
Fläche: 148 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Handwerkerhaus, umgebaut zum Hofhaus.;
Gebäude V 4, 10
(ID 195)
Fläche: 78 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di M. Sittius Potitus (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Sittius Potitus? Hofhaus, Handwerkerhaus?;
Gebäude V 4, 12.13
(ID 197)
Fläche: 282 qm
Räume
A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, S
Name(n)
Casa dei Natali di Roma; Casa della Fondazione di Roma; Casa delle Origini di Roma; Casa di M. Fabius Secundus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Fabius Secundus und der Optata. Casa delle Origini di Roma; Casa dei Natali di Roma; Casa della Fondazione di Roma.; SLuecke 2025: Die Bezeichnung "Casa delle origine di Roma" rührt von einem in dem Haus gefundenen Wandgemälde, das eine Szene mit Romulus und Remus zeigt.;
Gebäude V 4, a.11
(ID 198)
Fläche: 417 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della nuova Caccia; Casa di M. Lucretius Fronto
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der MM. Lucretii, Fronto und Lerus; Haus des M. Lucretius Fronto und M. Lucretius Lirus. Casa della nuova Caccia.;
Gebäude V 4, b
(ID 199)
Fläche: 176 qm
Räume
-
Name(n)
Casa V 4, b
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus.;
Gebäude V 4, c
(ID 200)
Fläche: 224 qm
Räume
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N
Name(n)
Casa degli Ori; Casa di M. Samellius Modestus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Santellius Modestus. Casa degli Ori.;
Gebäude V 6, 2
(ID 205)
Fläche: 34 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Reihenhaus?;
Gebäude V 6, 3
(ID 206)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Eingang;
Gebäude V 6, 4
(ID 207)
Fläche: 56 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (di un atleta?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Sportlers? ("di fronte al n. 10 dell is. XVI”).;
Gebäude V 6, 5
(ID 208)
Fläche: 75 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang, Kalkstein (5.6.7 ( + ) Erdb. 1980?).;
Gebäude V 6, 6
(ID 209)
Fläche: 112 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Nichts erkennbar, zugemauert (Treppe OG? zu 5).;
Gebäude V 6, 14
(ID 213)
Fläche: 33 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang;
Gebäude V 6, 15
(ID 214)
Fläche: 33 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang, posticum zu 14?;
Gebäude V 6, 16
(ID 215)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden zu 17? ;
Gebäude V 6, 17
(ID 216)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang n. Erdb.;
Gebäude V 6, 18
(ID 217)
Fläche: 45 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Gastronomie; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden zu 17 (?) (Bronzehandel?).;
Gebäude V 6, 19
(ID 218)
Fläche: 33 qm
Räume
-
Name(n)
Officina? Stalla?
Kategorien
Handel und Gewerbe; Stall; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt oder stabulum an der Porta del Vesuvio? ;
Gebäude V 6, b
(ID 220)
Fläche: 75 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang;
Gebäude V 6, c
(ID 221)
Fläche: 69 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Circinaeus Crescens
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Eckhaus; Werkstatt (?) des Circinaeus Crescens.;
Gebäude V 7, 1
(ID 222)
Fläche: 104 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di un ferramenta
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Eisenwarenhändlers.;
Gebäude V 7, 4
(ID 224)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Schmaler Hauseingang.;
Gebäude V 7, 5
(ID 225)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang.;
Gebäude V 7, 6
(ID 226)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Paris
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Paris.;
Gebäude VI 1, 1
(ID 227)
Fläche: 128 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Triclinio; caupona und hospitium des Agathus Vaius (?)
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium
Funde
Wandgemälde: Wandmalerei o. Beschr.
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Triclinio. caupona und hospitium des Agathus Vaius (?) im inneren Pomerium der Stadtmauer.;
Gebäude VI 1, 5
(ID 229)
Fläche: 83 qm
Räume
-
Name(n)
Popina
Kategorien
Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina.;
Gebäude VI 1, 6.7.8.24.25.26
(ID 230)
Fläche: 1038 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del salve; Casa delle Vestali; Casa di Claudio; Casa di Vesta; Domus des P. Varennius Zethus libertus; House of Ione
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus des P. Varennius Zethus libertus; Casa delle Vestali; Casa di Vesta; Casa di Claudio; Casa del salve; House of Ione.;
Gebäude VI 1, 17
(ID 235)
Fläche: 45 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona e thermopolium di Acisculus
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium und popina des Acisculus.;
Gebäude VI 1, 19
(ID 237)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Pozzo archaico
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Archaischer Tiefbrunnen (in der Antike zugefüllt) mit gewölbtem Überbau, eingeschlossen in den Bürgersteig.;
Gebäude VI 2, 2
(ID 244)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega; Haus und einräumiger Laden des lulius Caecilius Capella
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und einräumiger Laden des lulius Caecilius Capella, negotiator fur Metallwaren, Werkzeuge?;
Gebäude VI 2, 3.4.5.30.31
(ID 245)
Fläche: 946 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Cervo; Casa di Atteone; Casa di Sallustio; Domus des A. Cossius Libanus
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Aktaion
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus des A. Cossius Libanus mit caupona, diversorium und hospitium, Casa di Sallustio, Casa di Atteone; Casa del Cervo.;
Gebäude VI 2, 6
(ID 246)
Fläche: 99 qm
Räume
-
Name(n)
Panificio
Kategorien
Atriumhaus; Bäckerei; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Bäckerei zum Haus des A. Cossius Libanus;
Gebäude VI 2, 12
(ID 249)
Fläche: 196 qm
Räume
-
Name(n)
Casa piccola
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus.;
Gebäude VI 2, 13
(ID 250)
Fläche: 130 qm
Räume
-
Name(n)
Casa piccola
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus.;
Gebäude VI 2, 14
(ID 251)
Fläche: 156 qm
Räume
-
Name(n)
Casa delle Amazzoni; Casa delle Muse; Casa di Iside e di Osiride
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Amazone; Wandgemälde: Isis-Osiris-Harpokrates
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Schauspielers? Casa delle Amazzoni; Casa di Iside e di Osiride; Casa delle Muse.;
Gebäude VI 2, 25
(ID 257)
Fläche: 243 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hofhaus "mit erhaltenem Obergeschoß".;
Gebäude VI 2, 26
(ID 258)
Fläche: 151 qm
Räume
-
Name(n)
Officina con forno di fusione
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt mit Schmelzofen (eines plumbarius?). Unregelmäßiges Handwerkerhaus.;
Gebäude VI 2, 27
(ID 259)
Fläche: 64 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus "mit erhaltenem Obergeschoß".;
Gebäude VI 2, 28
(ID 260)
Fläche: 216 qm
Räume
-
Name(n)
Hospitium?
Kategorien
Atriumhaus; Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: hospitium?;
Gebäude VI 2, 29
(ID 261)
Fläche: 66 qm
Räume
-
Name(n)
Piccola casa di un artigiano?
Kategorien
Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Handwerkerhaus?;
Gebäude VI 3, 3.27.28
(ID 266)
Fläche: 385 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Forno; Panificio
Kategorien
Atriumhaus; Bäckerei
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Forno, Bäckerei.;
Gebäude VI 3, 4
(ID 267)
Fläche: 30 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Weinverkauf?).;
Gebäude VI 3, 5
(ID 268)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Einräumiger Laden.;
Gebäude VI 3, 8
(ID 269)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Einräumiger Laden.;
Gebäude VI 3, 9
(ID 270)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Einräumiger Laden.;
Gebäude VI 3, 14.15
(ID 273)
Fläche: 69 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Aquila ad ali spiegate; Haus des C. Julius Priscus (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des C. Julius Priscus (? - s. auch 12). Haus eines faber und negotiator aerarius oder ferrarius. Schmiedewerkstatt mit Wohnung. Casa del Aquila ad ali spiegate.;
Gebäude VI 3, 16.17
(ID 274)
Fläche: 57 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con officina e bottega (vendita di lampade?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus mit Wohnung, Werkstatt, Gastzimmern und Läden (u. a. Lampenverkauf?).;
Gebäude VI 3, 21
(ID 276)
Fläche: 92 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Wohnhaus.;
Gebäude VI 4, 1.2
(ID 280)
Fläche: 49 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega; Laden oder caupona des Olius Vulcentanus?
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
Wandgemälde: Lararium mit Schlange und Pinienzapfen
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder caupona des Olius Vulcentanus?;
Gebäude VI 4, 3.4
(ID 281)
Fläche: 100 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Vetti Caprasii; Casa di Marcello
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona und hospitium. Casa di Marcello. Casa dei Vetti Caprasii. Gasthaus, Speiselokal.;
Gebäude VI 4, 5
(ID 282)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Retrobottega.;
Gebäude VI 4, 6
(ID 283)
Fläche: 36 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Retrobottega.;
Gebäude VI 4, 7
(ID 292)
Fläche: 39 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden mit Retrobottega.;
Gebäude VI 4, 11.12
(ID 294)
Fläche: 123 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (di un marmorarius?)
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines marmorarius?;
Gebäude VI 5, 4
(ID 296)
Fläche: 437 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con atrio
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Atriumhaus.;
Gebäude VI 5, 5.6.21
(ID 297)
Fläche: 386 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Granduca Michele di Russia; Casa delle quattro colonne dipinte a musaico (a Scaglie)
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa delle quattro colonne dipinte a musaico (a Scaglie); Casa del Granduca Michele di Russia.;
Gebäude VI 5, 7
(ID 298)
Fläche: 834 qm
Räume
-
Name(n)
Giardino (di M. Valerius Abinnericus?)
Kategorien
Garten
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Gartengrundstück des M. Valerius Abinnericus?;
Gebäude VI 5, 9.10.19
(ID 300)
Fläche: 713 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Fiori; Casa del Cinghiale
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Weibliche, blumentragende Figuren
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa dei Fiori, Casa del Cinghiale. Doppelhaus mit Peristyl, Casa dei tre Cortili, vermutlich von 2 Familien bewohnt.;
Gebäude VI 5, 15
(ID 303)
Fläche: 163 qm
Räume
-
Name(n)
Panificio
Kategorien
Bäckerei; Herberge; Hospitium; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Bäckerei eines pistor dulciarius und Lebensmittelgeschäft (?), hospitium (?);
Gebäude VI 5, 16
(ID 304)
Fläche: 219 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Faventinus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Faventinus.;
Gebäude VI 6, 1.8.12.13
(ID 310)
Fläche: 2024 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Pansa; Haus der Olii, Primus und Paratus und T. Olius; Haus des C. Cuspius Pansa; Haus des Cn. Alleius Nigidius Maius
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Cn. Alleius Nigidius Maius; Haus der Olii, Primus und Paratus und T. Olius; Haus des Pansa, des C. Cuspius Pansa.;
Gebäude VI 6, 2
(ID 311)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Gemüse?).;
Gebäude VI 6, 3
(ID 312)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Blumengeschäft?).;
Gebäude VI 6, 9
(ID 315)
Fläche: 104 qm
Räume
-
Name(n)
Casa d'affitto
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Mietshaus.;
Gebäude VI 6, 11
(ID 317)
Fläche: 72 qm
Räume
-
Name(n)
Cortile e stalla
Kategorien
Wasserversorgung
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hof und Stall mit gemauertem Wasserkastell an der O-Wand.;
Gebäude VI 6, 14
(ID 320)
Fläche: 35 qm
Räume
-
Name(n)
Appartamento (di un schiavo?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine Wohnung eines Haussklaven?;
Gebäude VI 6, 15
(ID 321)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Appartamento (di un schiavo?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine Wohnung eines Haussklaven?;
Gebäude VI 6, 16
(ID 322)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Appartamento (di un schiavo?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine Wohnung eines Haussklaven?;
Gebäude VI 6, 22
(ID 324)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio (di Fiori?) di servus atriensis
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Blumengeschäft (?) des servus atriensis.;
Gebäude VI 6, 23
(ID 325)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VI 7, 3
(ID 327)
Fläche: 226 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con atrio tetrastilo
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa con atrio tetrastilo.;
Gebäude VI 7, 7
(ID 329)
Fläche: 163 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Privathaus.;
Gebäude VI 7, 15
(ID 332)
Fläche: 209 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Duca d'Aumale; Casa di M. Spurius Am.
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Spurius Am.; Public Inn; Treffpunkt der Obstverkäufer (?); Casa del Duca d'Aumale.;
Gebäude VI 7, 16.17
(ID 333)
Fläche: 190 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di M. Ubonius Cogitatus e Fuscus; Casa di Mercurio
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus des M. Ubonius Cogitatus mit Einliegerwohnung des Fuscus. Casa di M. Ubonius Cogitatus e Fuscus. Casa di Mercurio.;
Gebäude VI 7, 1.2.18
(ID 334)
Fläche: 385 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dell'Ermafrodito; Casa della Toletta dell'Ermafrodito; Casa di Adone ferito; Casa di Ione; Casa di Venere ed Adone
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Asellinus mit procurator Onomastus; Casa di Adone ferito; Casa di Venere ed Adone; Casa dell' Ermafrodito; Casa della Toletta dell' Ermafrodito; Casa di lone.;
Gebäude VI 7, 19
(ID 335)
Fläche: 388 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Inaco ed Io; Haus der Fabii Tyrannus und Iarinus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Fabii Tyrannus und Iarinus; Casa di Inaco ed Io. ;
Gebäude VI 7, 20.21.22
(ID 336)
Fläche: 1126 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Vasi d'Argento; Casa dell'Argenteria
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Grundstück des A. Herennuleius Communis mit 3 Häusern. Haus der LL. Laelii Erastus und Trophimus? Haus des P. Antistius Maximus; 20-22 Wohnung und (Reparatur?)- Werkstatt eines Metallhandwerkers (Silberschmied?); Casa dei Vasi d'Argento; Casa dell' Argenteria.;
Gebäude VI 7, 23
(ID 337)
Fläche: 695 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dell'Argenteria; Casa di Apollo
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus mit dem bisellium; Casa di Apollo.;
Gebäude VI 7, 24
(ID 338)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Scala
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Treppe zu einer Wohnung im OG (über 25?).;
Gebäude VI 7, 25
(ID 339)
Fläche: 146 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Wohnhaus.;
Gebäude VI 7, 26
(ID 340)
Fläche: 133 qm
Räume
-
Name(n)
Stabulum?
Kategorien
Stall
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Larenheiligtum vor der am agger der Stadtmauer zugemauerten Straße. stabulum?;
Gebäude VI 8, 3.4.5.6.7.8
(ID 343)
Fläche: 416 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Cave Canem; Casa del poeta tragico; Casa di Glauco; Casa di Omero; Haus des Aninius; Haus des M. P. Cepius; Haus und officina fullonica des L. Veranius Hypsaeus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Entführung der Helena; Wandgemälde: Entlassung der Briséis; Wandgemälde: Opferung der Iphigenie
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Aninius; Haus des M. P. Cepius; Casa del Poeta tragico; Casa del Cave Canem; Casa di Omero; Casa di Glauco.;
Gebäude VI 8, 11
(ID 345)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio (di alimentari?)
Kategorien
Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft? bottega olearia?;
Gebäude VI 8, 14
(ID 346)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Sacrarium compitale? Tonstrina?
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Sacrarium compitale? Tonstrina?;
Gebäude VI 8, 15
(ID 347)
Fläche: 39 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio (di alimentari?)
Kategorien
Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft ?;
Gebäude VI 8, 16
(ID 348)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Bronze- und Eisenwaren)?;
Gebäude VI 8, 17
(ID 349)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittel)?;
Gebäude VI 8, 18
(ID 350)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Nebenraum (Haushaltswaren?).;
Gebäude VI 8, 19
(ID 351)
Fläche: 16 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Nebenraum (Getränkeverkauf?).;
Gebäude VI 8, 2.20.21
(ID 352)
Fläche: 785 qm
Räume
10, 11$1, 11$2, 11$3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40a, 42, 7, A, B, C
Name(n)
Casa e fullonica di L. Veranius Hypsaeus
Kategorien
Atriumhaus; fullonica; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und officina fullonica des L. Veranius Hypsaeus.;
Gebäude VI 8, 1.22
(ID 353)
Fläche: 529 qm
Räume
-
Name(n)
Casa degli Elvi; Casa della Fontana grande; Casa della prima Fontana a mosaico; Casa di Livio; Haus des Helvius Vestalis, patronus pomariorum
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Helvius Vestalis, patronus pomariorum. Casa degli Elvi; Casa di Livio; Casa della Fontana Grande, Casa della prima Fontana a mosaico.;
Gebäude VI 8, 23.24
(ID 354)
Fläche: 578 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Fontana piccola; Casa della Fontana piccola a mosaico; Domus di Memor; House of the Landscapes
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus di Memor; "inquilino di Helvius Vestalis"; Casa della Fontana piccola; Casa della Fontana piccola a mosaico; House of the Landscapes. Doppelatriumhaus.; Strocka 1996: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa della Fontana piccola : (VI 8,23.24) [1996];
Gebäude VI 9, 1.14
(ID 355)
Fläche: 738 qm
Räume
-
Name(n)
Casa d'Iside ed Io; Casa del Duca d'Aumale; Casa VI 9, 1
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium
Funde
Wandgemälde: Isis und Io
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: praedium civicum, hospitium und caupona des Gabinius; Casa d' lside ed Io; Casa del Duca d' Aumale.;
Gebäude VI 9, 2.13
(ID 356)
Fläche: 1210 qm
Räume
-
Name(n)
Casa delle Nereidi; Casa di Meleagro; Haus des L. Cornelius Primogenes
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Cornelius Primogenes; Casa di Meleagro; Casa delle Nereidi.;
Gebäude VI 9, 6.7.8.9
(ID 358)
Fläche: 1461 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Dioscuri; Casa del Questore; Casa di Castore e Polluce
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Nigidius Vaccula oder N. Nasennius Nigidius Vaccula. 7 vermietet an den libertus Cn. Caetronius Eutychus; Casa dei Dioscuri; Casa di Castore e Polluce; Casa del Questore.;
Gebäude VI 10, 1.19
(ID 361)
Fläche: 43 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona della Via di Mercurio
Kategorien
Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe
Funde
Wandgemälde: Wandmalerei o. Beschr.
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona della Via di Mercurio, lupanare, osteria, popina.;
Gebäude VI 10, 2
(ID 362)
Fläche: 264 qm
Räume
-
Name(n)
Casa degli Cinque Scheletri; Casa dei Cinque Scheletri; Casa del Vaticinio di Cassandra
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Obellius (?) (Avellius) Firmus? sogen. Casa degli Cinque Scheletri (Lupanare zu 1?); Casa del Vaticinio di Cassandra.;
Gebäude VI 10, 5
(ID 364)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Primus. Lebensmittelgeschäft?;
Gebäude VI 10, 7.16
(ID 366)
Fläche: 660 qm
Räume
1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 2, 23|1, 24|1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa dell'Ancora Nera; Casa di Nettuno; Haus des Melissaeus und der Sucula lib.
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Melissaeus und der Sucula lib.; Casa dell' Ancora Nera; Casa di Nettuno. Melissaeus betrieb Seehandel und Schiffsbau.;
Gebäude VI 10, 10
(ID 367)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Schiffszubehör?).;
Gebäude VI 10, 12
(ID 369)
Fläche: 28 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Schmuck- und Metallwaren).;
Gebäude VI 10, 13
(ID 370)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude VI 10, 15
(ID 372)
Fläche: 39 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden.;
Gebäude VI 11, 3
(ID 377)
Fläche: 42 qm
Räume
-
Name(n)
Giardino (?)
Kategorien
Garten
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Gartengrundstück. Nutzgarten (?); Shophouse or Trucks, Garden.;
Gebäude VI 11, 5.15.16
(ID 379)
Fläche: 479 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Restituta con lupanare; Lupanar der Aphrodite, Secunda, Nymphe, Spendusa, Veneria, Restituta, Timele
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Garten; Handel und Gewerbe; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus der Restituta mit Lupanar in 16 und großem Garten; Lupanar der Aphrodite, Secunda, Nymphe, Spendusa, Veneria, Restituta, Timele.;
Gebäude VI 11, 7
(ID 381)
Fläche: 127 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (con officina?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus mit Werkstatt?;
Gebäude VI 11, 8
(ID 382)
Fläche: 98 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Eutychus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Eutychus, servus oder procurator des Fuficius.;
Gebäude VI 11, 9.10
(ID 383)
Fläche: 1779 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2b, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa del labirinto; Casa delle Terme private; Haus der Sextilier
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Fuficius Januarius; Casa del Labirinto; Casa delle Terme private; Wohnung des Messenius und des Hermes, Coloniae servus (Aufseher der Geflügelzucht) (in 9?). Tatsächlich von ca. 70 v. bis 79 n. Chr. Haus der Sextilier (Besitzerinschrift auf 50-Pfund-Gewicht).; Strocka 1991: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa del Labirinto : VI, 11,8-10 [1991];
Gebäude VI 11, 14
(ID 386)
Fläche: 111 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (con officina?)
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus mit Werkstatt?;
Gebäude VI 12, 1.2.3.5.7.8
(ID 390)
Fläche: 2918 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28_1, 28_2, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45A, 45B, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50A, 51, 52, 53, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa del Fauno; Casa del Fauno danzante; Casa del Gran Musaico; Casa del HAVE; Casa di Goethe; Haus der gens Cassia; Haus des Ägypters Abarces
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der gens Cassia, M. Marcellus und Saturninus mit Wohnung der Lucretii Satrii; Casa del Fauno oder del Fauno danzante; Casa del Gran Musaico; Casa del HAVE; Casa di Goethe; Haus des Ägypters Abarces.;
Gebäude VI 13, 5
(ID 392)
Fläche: 28 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Webwaren? Haushaltswaren).;
Gebäude VI 13, 7
(ID 394)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Eisenwaren, Werkzeuge) mit Reparaturwerkstatt?;
Gebäude VI 13, 15
(ID 399)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VI 14, 2
(ID 406)
Fläche: 121 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung (Fischhalle).;
Gebäude VI 14, 3
(ID 407)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Retrobottega. Lebensmittelgeschäft?;
Gebäude VI 14, 4
(ID 408)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Nebenraum.;
Gebäude VI 14, 5
(ID 409)
Fläche: 151 qm
Räume
-
Name(n)
Casa d'Adelaide d'Inghilterra; Casa dei cinque consolati; Casa di Marte
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa di Marte; Casa dei cinque consolati; Casa d'Adelaide d'Inghilterra.;
Gebäude VI 14, 6
(ID 410)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Nebenraum.;
Gebäude VI 14, 7
(ID 411)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Nebenraum.;
Gebäude VI 14, 10
(ID 413)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Nebenraum und ohne Einbauten. Lebensmittelgeschäft?;
Gebäude VI 14, 11
(ID 414)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleiner Laden.;
Gebäude VI 14, 12.13.16.17
(ID 415)
Fläche: 482 qm
Räume
-
Name(n)
Haus des L. Numisius Rarus und seiner Frau Oppia?
Kategorien
Atriumhaus; Lebensmittel; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Numisius Rarus und seiner Frau Oppia? Lebensmittel-und Weingroßhandel (?) mit sodalicium cauponum.;
Gebäude VI 14, 14
(ID 416)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden ohne Nebenraum. Lebensmittelgeschäft?;
Gebäude VI 14, 15
(ID 417)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Hinterraum (Metallwaren).;
Gebäude VI 14, 18.19.20
(ID 419)
Fläche: 692 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Colonna Etrusca II; Casa di Orfeo; Haus des M. Vesonius Primus und der Cornelia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Vesonius Primus und der Cornelia; Casa di Orfeo; Casa della Colonna Etrusca II.;
Gebäude VI 14, 25
(ID 422)
Fläche: 161 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Unregelmäßiges Haus, officina tinctoria?;
Gebäude VI 14, 26
(ID 423)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Hinterzimmer.;
Gebäude VI 14, 27
(ID 424)
Fläche: 135 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di M. Memmius Auctus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Memmius Auctus, Weinhändler (auch Handel mit Klein-Skulpturen?).;
Gebäude VI 14, 37
(ID 428)
Fläche: 94 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Potitus
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: officina lignaria des ludimagister Potitus lib. Poppaei Sabini.;
Gebäude VI 14, 38
(ID 429)
Fläche: 450 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di C. Poppaeus Firmus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des C. Poppaeus Firmus.;
Gebäude VI 14, 39
(ID 430)
Fläche: 215 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Clodius; Casa Lucrum Gaudium
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Axius Gun., faber tornator mit Wohnung des L. Clodius Alypus im OG?; Casa Lucrum Gaudium.;
Gebäude VI 14, 40
(ID 431)
Fläche: 349 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus.;
Gebäude VI 14, 43
(ID 433)
Fläche: 523 qm
Räume
-
Name(n)
Casa degli scienziati; Casa del Lupanare grande
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Lupanare grande; Casa degli Scienziati.;
Gebäude VI 15, 1.27
(ID 435)
Fläche: 1055 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Vettii; Haus der Vettii Caprasii
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der AA. Vettii, Restitutus und Conviva, Weingroßhändler. Miteinwohner Liberalis, Hilarius und Verecundus; Haus der Vettii Caprasii, Wohnung des P. Crusius Faustus.;
Gebäude VI 15, 3
(ID 437)
Fläche: 63 qm
Räume
-
Name(n)
Fullonica di Mustius e Ovia
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine fullonica des Mustius und der Ovia, Familienbetrieb (gemietet vom Besitzer des Hauses Nr. 2). Mustius war im Nebenberuf scriptor für programmata.;
Gebäude VI 15, 6
(ID 440)
Fläche: 235 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Forno di ferro; Casa di A. Caesius Valens e di N. Herennius Nardus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des A. Caesius Valens und des N. Herrennius Nardus; Casa del Forno di ferro.;
Gebäude VI 15, 7.8
(ID 441)
Fläche: 235 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Principe di Napoli; Casa del Sileno
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Sileno; Casa del Principe di Napoli (mit Einwohnern Heracla und Aegle?).; Strocka 1984: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa del Principe di Napoli : (VI 15, 7.8) [1984];
Gebäude VI 15, 9
(ID 442)
Fläche: 130 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del doppio impluvio
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus mit zweistöckigem atrium; Casa del doppio impluvio.;
Gebäude VI 15, 10
(ID 443)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VI 15, 21
(ID 448)
Fläche: 63 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di un artigiano
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Handwerkerhaus.;
Gebäude VI 15, 22
(ID 449)
Fläche: 104 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Cinnius Fortunatus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Cinnius Fortunatus.;
Gebäude VI 15, 23
(ID 450)
Fläche: 402 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hofhaus, hospitium?;
Gebäude VI 16, 5
(ID 454)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden in Verbindung mit 6?;
Gebäude VI 16,
(ID 455)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Fullonica
Kategorien
Atriumhaus; fullonica; Gastronomie; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Fullonica.;
Gebäude VI 16, 10
(ID 457)
Fläche: 126 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega di Erastus
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Erastus musivarius (?), officina musivaria mit Laden und Wohnung.;
Gebäude VI 16, 11
(ID 458)
Fläche: 85 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus. Bronze-Reparaturen (?) und -Verkauf.;
Gebäude VI 16, 12
(ID 459)
Fläche: 60 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina, thermopolium.;
Gebäude VI 16, 15.16.17
(ID 461)
Fläche: 170 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dell'ara massima; Casa di Narcisso
Kategorien
Atriumhaus; Heiligtum, Altar; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Pinarius. Casa dell' Ara massima; Casa di Narcisso.; Strocka 1992: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa dell'Ara massima : (VI 16,15-17) [1992];
Gebäude VI 16, 18
(ID 462)
Fläche: 88 qm
Räume
-
Name(n)
Officina
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt.;
Gebäude VI 16, 25
(ID 465)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VI 16, 28
(ID 467)
Fläche: 138 qm
Räume
-
Name(n)
Casa; Casa della Caccia di Tori; Haus der Coponii; Maison de la chasse de taureaux
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Coponii; Casa della Caccia di Tori (de la chasse de taureaux).;
Gebäude VI 16, 31
(ID 469)
Fläche: 139 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Handwerkerhaus?;
Gebäude VI 16, 32.33
(ID 470)
Fläche: 137 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di L. Aurunculeius Secundio
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; thermopolium; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina mit thermopolium, Lupanar und Wohnung des L. Aurunculeius Secundio und des A. B. L.;
Gebäude VI 16, 34
(ID 471)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude VI 16, 35
(ID 472)
Fläche: 119 qm
Räume
-
Name(n)
Casetta di Roma
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casetta di Roma.;
Gebäude VI 16, 6.7.38
(ID 474)
Fläche: 736 qm
Räume
-
Name(n)
Casa degli Amorini dorati
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: posticum zu 7.; Strocka 1992: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa degli Amorini dorati : (VI 16,7.38) [1992];
Gebäude VI 17, 1.2.3.4
(ID 476)
Fläche: 603 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei veicoli d'affitto; Hospitium di Albinus
Kategorien
Atriumhaus; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium; Stall; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Restaurationsbetrieb mit stabulum, popina, hospitium des Albinus, statio caepariorum, statio mulionum (Eigentümer C. Julius Polybius); Casa dei veicoli d'affitto.;
Gebäude VI 17, 7
(ID 478)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VI 17, 8
(ID 479)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude VI 17, 18
(ID 483)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Gastronomie; Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt.;
Gebäude VI 17, 31
(ID 486)
Fläche: 46 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Laden (Lebensmittelgeschäft) des Svettius Erennius? Grundstück: Masseria di Cuomo.;
Gebäude VI 17, 32.33.34.35.36.37.38.39
(ID 487)
Fläche: 1307 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Diana II; Casa di Fabius Eupor
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Fabius Eupor, lib. des M. Fabius Thelus (?), negotiator vinarius; Princeps libertinorum; Archisynagogus der Hebräer; Casa della Diana II. Doppelatriumhaus mit Läden.;
Gebäude VI 17, 42.43.44
(ID 489)
Fläche: 784 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Braccioletto d'oro; Casa delle Nozze di Alessandro; Casa di Alessandro e Rossane
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Hochzeit Alexanders mit Roxane
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Cerrinius Vatia, patronus mulionum? Casa di Alessandro e Rossane, Casa delle Nozze di Alessandro; Casa del Braccioletto d'oro.;
Gebäude VII 1, 2
(ID 491)
Fläche: 18 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Proculus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Proculus (Metall-, Holz- oder Steinwaren)? In der NO-Ecke Antrittsstufen und Podium zur Treppe zum HG.;
Gebäude VII 1, 3
(ID 492)
Fläche: 18 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Clodius Sagarius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Clodius Sagarius (Metall-, Holz- oder Steinwaren).;
Gebäude VII 1, 4
(ID 493)
Fläche: 17 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Sagata
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des (der) Sagata?;
Gebäude VII 1, 5
(ID 494)
Fläche: 23 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Sestius Venustius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Sestius Venustius (Barbier?).;
Gebäude VII 1, 6
(ID 495)
Fläche: 23 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Stronnius Valens
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Stronnius Valens.;
Gebäude VII 1, 7
(ID 496)
Fläche: 19 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di M. Am(p)ullius Cosmus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des M. Am(p)ullius Cosmus (Schlosser).;
Gebäude VII 1, 8.14.15.16.17.48.50.51
(ID 497)
Fläche: 2610 qm
Räume
1, 1-17, 1-51, 1-53, 1-54, 1-55, 1-56, 1-57, 1-58, 10, 11, 12, 1a, 1b, 1c, 2, 2-17, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, C', D, E, F, G, K, L, M, N1, N2, N3, N4, O, O', P, Q, R, S, T, U, V, W, W1, X
Name(n)
Nuove terme alla Strada Stabiana; Terme Stabiane; Thermae Stabianae
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Thermae Stabianae; Bagni pubblici; Nuove terme alla Strada Stabiana. Doppelanlage vom asymetrischen Reihentypus mit Palästra und natatio.;
Gebäude VII 1, 9
(ID 498)
Fläche: 24 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Sestius Proculus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Sestius Proculus (Toilettenartikel und Gerätschaften für Frauen).;
Gebäude VII 1, 10
(ID 499)
Fläche: 24 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 1, 11
(ID 500)
Fläche: 22 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Sabinus (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Sabinus? (Handel mit Statuetten aller Art?).;
Gebäude VII 1, 18
(ID 505)
Fläche: 23 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Langer, schmaler Raum (Laden eines ambulanten Händlers?).;
Gebäude VII 1, 19
(ID 506)
Fläche: 50 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Metall-, Holz- oder Steinarbeiten).;
Gebäude VII 1, 20
(ID 507)
Fläche: 40 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Bottega
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Retrobottega (Weinverkauf?), Lupanar im OG?;
Gebäude VII 1, 23
(ID 509)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Latrina
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Öffentliche Latrine.;
Gebäude VII 1, 24
(ID 510)
Fläche: 8 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (eines ambulanten Händlers?).;
Gebäude VII 1, 25.46.47
(ID 511)
Fläche: 1055 qm
Räume
1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18a, 18b, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 8, 9, a, b
Name(n)
Casa dei Principi di Russia; Casa di Salve Lucru; Casa di Siricus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Der verwundete Aeneas
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der PP. Vedii Siricus und Nummianus mit P. Vedius Ceratus libertus (Kaufleute); Casa di Salve Lucru; Casa dei Principi di Russia; 2 Atriumhäuser (25 und 47).;
Gebäude VII 1, 26
(ID 512)
Fläche: 25 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Ceratus (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden des Ceratus?;
Gebäude VII 1, 27
(ID 513)
Fläche: 146 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7
Name(n)
Casa di Vibia e Ameia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus (der Vibia und Ameia?), 79 n. Chr. geschlossen.;
Gebäude VII 1, 30
(ID 515)
Fläche: 34 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Stalla di cavalli
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Pferdestall.;
Gebäude VII 1, 31
(ID 516)
Fläche: 50 qm
Räume
1, 2, 3
Name(n)
Forgia (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Schmiede oder Reparaturwerkstatt.;
Gebäude VII 1, 36.37
(ID 517)
Fläche: 338 qm
Räume
1, 2, a, b, d, e, f, g, h, i, k, l, m
Name(n)
Casa del panettiere
Kategorien
Atriumhaus; Bäckerei; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Pistrinum des Lucius und des Q. Granius Verus, Großbäckerei. Casa del Panettiere, mit Bäckerladen.;
Gebäude VII 1, 40.41.42.43
(ID 519)
Fläche: 716 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19s1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2a, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a
Name(n)
Casa del Delfino; Casa di Cesio Blando; Casa di M. Caesius Blandus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Caesius Blandus (centurio) mit officina sutoria des M. Nonius Campanus (miles cohortis Vllll praetoriae des Caesius) mit den sutores Menecrates und Vesbinus; Casa del Delfino.;
Gebäude VII 1, 49
(ID 523)
Fläche: 27 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des M. S. C., des M. Stabius Chryseros.;
Gebäude VII 1, 52
(ID 525)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Tonstrina (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: tonstrina?;
Gebäude VII 1, 53.54.55.56.57.58
(ID 526)
Fläche: 127 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Vermutlich Läden für Badegeräte, Kosmetik und Palästrabedarf. Ladenkette, an der Rückwand verbunden durch rückwärtigen Gang mit Eingang 58 von der Straße.;
Gebäude VII 1, 60
(ID 527)
Fläche: 30 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden.;
Gebäude VII 1, 61
(ID 528)
Fläche: 32 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden (Herstellung und Verkauf von Kosmetik-Artikeln?).;
Gebäude VII 2, 1
(ID 529)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (eines Intarsienlegers?).;
Gebäude VII 2, 2
(ID 530)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Marcellus?;
Gebäude VII 2, 3.6.7
(ID 531)
Fläche: 593 qm
Räume
3, 3a, a, b, b'''-3, b''-3, b'-3, b-3, c, d, d-3, e, f, f-3, g, g-3, h, h-3, i, j, k-3, l, m, n, o, p, q, r-3, s-3, t-3
Name(n)
Casa dei TT. Terentii
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Portrait des Bäckers Terentius Neo und seiner Frau
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der TT. Terentii, Neo studiosus und Proculus pistor und der Fabia Sabina, mit pistrinum des T. Terentius Proculus.;
Gebäude VII 2, 4
(ID 532)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Brotverkauf?).;
Gebäude VII 2, 5
(ID 533)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Sabinus?;
Gebäude VII 2, 7
(ID 534)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden.;
Gebäude VII 2, 10
(ID 537)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (x).;
Gebäude VII 2, 11
(ID 538)
Fläche: 419 qm
Räume
a, b, b', b'', c, d, e, f, g, i, l, m, mS1, n, o, p
Name(n)
Casa e tintoria di Ubonius Offector
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Infectorium des Ubonius; officina tintoria Ubonius, offector, tintoria di panni (vgl. IX 3, 1.2 officina offectoria).;
Gebäude VII 2, 12
(ID 539)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona
Kategorien
Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona mit Lupanar?;
Gebäude VII 2, 13
(ID 540)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung im OG zu 14 (?) des Felix?;
Gebäude VII 2, 16
(ID 542)
Fläche: 674 qm
Räume
1, 2, 3, a, b, c, d, e, f, g, h, h', h'', i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, y, z, z'
Name(n)
Casa di Teseo; House of the American Admiral; House of the Seven Skeletons
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa di Teseo; House of the Seven Skeletons; House of the American Admiral (David Glasgow Faragut).;
Gebäude VII 2, 17
(ID 543)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleiner Laden.;
Gebäude VII 2, 18.19.42
(ID 544)
Fläche: 729 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, r', r'', r''', r1, r2, r3, r4, r5, s, t, u, v
Name(n)
Casa di C. Vibius Italus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der CC. Vibi, C. und Italus (ehemalige Militärs, dann mercatores) und der Vibia Tertulla.;
Gebäude VII 2, 41a.20.21.41
(ID 545)
Fläche: 1034 qm
Räume
1, 2, 3, a, a-41, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o1, o2, o3, p, q, r, s, t, u, u', u'', u''', v, x, y, z, z1, z2
Name(n)
Casa dei Marmi; Casa di N. Popidius Priscus
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und Grundstück der NN. Popidii, Priscus, Ampliatus und Celsinus und der Corelia Celsa (Offiziersfamilie). M. Fabius Lalus und L. Ninnius Optatus (inquilini). Casa dei Marmi. 41.41a Weinhandlung des Macerio (Fiorelli: popina).;
Gebäude VII 2, 22
(ID 546)
Fläche: 196 qm
Räume
a, b, d, e, f, h, o
Name(n)
Casa dei Forni
Kategorien
Atriumhaus; Bäckerei
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Eckhaus mit großer Süßwarenbäckerei des M. Fabius Lalus.;
Gebäude VII 2, 23
(ID 547)
Fläche: 221 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, i, k, k', l, m, n, o, p, q, r
Name(n)
Casa di Amore punito; Haus des Vettius
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Vettius. Casa di Amore punito.;
Gebäude VII 2, 24.25.26
(ID 548)
Fläche: 217 qm
Räume
2, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p
Name(n)
Casa della Caccia Nuova; Casa delle Quadrighe
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Marine-Veteranen? Casa delle Quadrighe; Casa della Caccia Nuova.;
Gebäude VII 2, 32.33
(ID 550)
Fläche: 36 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona di Philippus
Kategorien
Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna vinaria und caupona des Philippus (mit cella meretricia in 28?). Kleines Eckhaus, Zimmer im OG (mit Lupanar?).;
Gebäude VII 2, 34
(ID 551)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Philippus?;
Gebäude VII 2, 36
(ID 553)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude VII 2, 40
(ID 555)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude VII 2, 43
(ID 557)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Magonius.;
Gebäude VII 2, 44.45
(ID 558)
Fläche: 196 qm
Räume
1, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m
Name(n)
Casa dell'Orso; Casa dell'Orso ferito; Taberna dei Seri bibi
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Gasthaus des Sizilianers Castresis (?) mit taberna vinaria der puella Hedone, Casa dell'Orso; Casa dell'Orso ferito; taberna dei Seri bibi (mit Lupanar?).; Strocka 1988: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa dell'Orso : VII 2,44-46 [1988];
Gebäude VII 2, 46
(ID 559)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden des figulus (?) Colepius?;
Gebäude VII 2, 47
(ID 560)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Latrina pubblica
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Öffentliche Latrine.;
Gebäude VII 2, 50
(ID 562)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude VII 2, 51
(ID 563)
Fläche: 298 qm
Räume
1, 2, a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, p, q, r, s
Name(n)
Casa degli Suettii, Potitus ed Elainus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Suettii, Potitus und Elainus, dissignator.;
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID 565)
Fläche: 288 qm
Räume
a, a-3, b, b-3, c, d, d-3, e, e-3, f, f-3, g, g-3, h, h-3, i, k, l, m, n, o, p
Name(n)
Casa di C. Memmius con officina vinaria, caupona e botteghe; Haus mit dem 'etruskischen' Kapitell
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus des C. Memmius mit officina vinaria, caupona und Läden. Haus mit dem 'etruskischen' Kapitell.;
Gebäude VII 3, 4.6
(ID 566)
Fläche: 395 qm
Räume
a, a-4, b, b-4, c, c-4, d, d-4, e, f, f-4, g, g-4, h, i, i-4, l, m, n, o, p
Name(n)
Casa con popina
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit popina, pistrinum dulciarium und Läden.;
Gebäude VII 3, 8
(ID 567)
Fläche: 195 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, o
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Laden.;
Gebäude VII 3, 9
(ID 568)
Fläche: 85 qm
Räume
a, b, c, d, e
Name(n)
Bottega, Popina (?)
Kategorien
Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina?;
Gebäude VII 3, 10
(ID 569)
Fläche: 56 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Bottega/Casa
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung.;
Gebäude VII 3, 16
(ID 570)
Fläche: 13 qm
Räume
n
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 3, 18
(ID 572)
Fläche: 22 qm
Räume
s
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Eisenwaren?) des Rubr...us?;
Gebäude VII 3, 19
(ID 573)
Fläche: 19 qm
Räume
t
Name(n)
Bottega di Secundus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Secundus, scriptor für Theateranzeigen? Kollege des perfusor? ;
Gebäude VII 3, 20
(ID 574)
Fläche: 19 qm
Räume
u
Name(n)
Casa (Bottega?) di Rubellius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Rubellius? (Lebensmittelgeschäft)?;
Gebäude VII 3, 21
(ID 575)
Fläche: 84 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i
Name(n)
Bottega e popina di Euhodus
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden, Lokal des Euhodus, perfusor? ;
Gebäude VII 3, 26.27.28
(ID 578)
Fläche: 62 qm
Räume
a, a'
Name(n)
Caupona e lupanare di Phoebus ed Euplia
Kategorien
Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium, caupona und Lupanar des Phoebus und der Euplia (puella).;
Gebäude VII 3, 29
(ID 579)
Fläche: 347 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, u', v, v', x, y
Name(n)
Haus des M. Spurius Me(n)sor
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Spurius Me(n)sor, (agri)mensor?;
Gebäude VII 3, 30
(ID 580)
Fläche: 177 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k
Name(n)
Casa del Magistrato anonimo; Casa del panettiere
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Magistrato anonimo; sog. Casa del panettiere.;
Gebäude VII 4, 1
(ID 584)
Fläche: 225 qm
Räume
-
Name(n)
Aedes della Fortuna Augusta; Tempel der Fortuna Augusta
Kategorien
Heiligtum; Heiligtum, Altar
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Tempel der Fortuna Augusta; Aedes Fortunae Augustae.;
Gebäude VII 4, 4
(ID 585)
Fläche: 69 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium, popina
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium. Popina.;
Gebäude VII 4, 8
(ID 587)
Fläche: 64 qm
Räume
-
Name(n)
Angiportus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: angiportus, auf den 3 postica umliegender Häuser münden (10.59.62). ;
Gebäude VII 4, 11
(ID 589)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Porticus Tulliana
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Haushaltswaren?).;
Gebäude VII 4, 14
(ID 591)
Fläche: 54 qm
Räume
-
Name(n)
Officina e bottega di Aurelius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Aurelius (Weinhandlung?).;
Gebäude VII 4, 15.16
(ID 592)
Fläche: 30 qm
Räume
-
Name(n)
Corporazione dei Facchini di piazza; Taberna vinaria di Samellius (?)
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna vinaria des Samellius (?), caupona, Sitz des sodalicium Saccarium; Corporazione dei Facchini di piazza; Besitzer oder Pächter des Sizilianers Castresis?;
Gebäude VII 4, 17
(ID 593)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio (di alimentari?)
Kategorien
Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft?;
Gebäude VII 4, 18
(ID 594)
Fläche: 110 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus.;
Gebäude VII 4, 19
(ID 595)
Fläche: 59 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 4, 20
(ID 596)
Fläche: 73 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del mercante di vino; Corporazione dei Facchini di piazza
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Mercante di vino; Casa del Pavone; Kleines Geschäftshaus. ;
Gebäude VII 4, 28
(ID 599)
Fläche: 35 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Eisenwerkzeuge?).;
Gebäude VII 4, 29
(ID 600)
Fläche: 149 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Pasticciere
Kategorien
Bäckerei; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Bäckerei, Laden und posticum zu 57.;
Gebäude VII 4, 30
(ID 601)
Fläche: 36 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 4, 31.32.33.50.51
(ID 602)
Fläche: 1614 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 18c, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 53', 54, 56, 57, 59, 6, 60, 7, 8, 9
Name(n)
Casa degli Capitelli colorati; Casa di Arianna
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa degli Capitelli colorati; Casa di Arianna; 32 Laden des Verpus? Negozio del vinum Arrianum.;
Gebäude VII 4, 34
(ID 603)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden eines ambulanten Händlers?;
Gebäude VII 4, 35
(ID 604)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden?;
Gebäude VII 4, 36
(ID 605)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 4, 37
(ID 606)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Lupanare (?)
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden eines ambulanten Händlers? Cella meretricia?;
Gebäude VII 4, 42
(ID 608)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Lupanare piccolo
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Cella meretricia. Lupanare piccolo.;
Gebäude VII 4, 44
(ID 610)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Latrina sotto scala
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe; Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: R. Latrine mit Rohr vom OG unter separater Treppe zum OG (Lupanar).;
Gebäude VII 4, 43.48
(ID 612)
Fläche: 412 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della caccia antica; Casa di Dedalo e Pasifae
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Gens Maria, Haus des Marius. Casa della Caccia antica; Casa di Dedalo e Pasifae.; Strocka 2002: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa della Caccia antica (VII 4,48) [2002];
Gebäude VII 4, 49
(ID 613)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Fischgeschäft?).;
Gebäude VII 4,
(ID 614)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Zu 31.32.33.;
Gebäude VII 4, 52
(ID 615)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 4, 55
(ID 617)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden oder Werkstatt.;
Gebäude VII 4, 56
(ID 618)
Fläche: 213 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Granduca di Toscana; Casa del Sileno di Marmo; Casa della fontana; Casa detto del forno a riverbero
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Granduca di Toscana; Casa della Fontana: Casa del Sileno di Marmo; Casa detto del forno a riverbero.; Strocka 1994: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa del Granduca (VII 4,56) und Casa dei Capitelli figurati (VII 4,57) [1994];
Gebäude VII 4, 29.57
(ID 619)
Fläche: 884 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Capitelli dei Satiri; Casa dei Capitelli figurati
Kategorien
Atriumhaus; Bäckerei; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa dei Capitelli figurati; Casa dei Capitelli dei Satiri. Im Peristyl 57 officina textoria, im Nebenhaus 29 Süßwarenbäckerei mit Laden?; Strocka 1994: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa del Granduca (VII 4,56) und Casa dei Capitelli figurati (VII 4,57) [1994];
Gebäude VII 4, 8A.59
(ID 620)
Fläche: 644 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Bronzi; Casa della parete nera
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: 2 miteinander verbundene Häuser der gens Tullia mit Läden: 59 Haus eines Bronze-Großhändlers; Casa dei Bronzi; Casa della Parete nera; 62: Wohnhaus des L. Tullius Faustus, (Marmorimporteur'?) mit Stukkateur-Werkstatt (vgl. auch oben unter 2: Werkstatt eines marmorarius); Casa delle Forme di Creta.; Strocka 2000: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa della Parete nera (VII 4, 58 - 60) und Casa delle Forme di creta (VII 4, 61 - 63) [2000];
Gebäude VII 5, 1
(ID 621)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Scala (Appartamento del balneator
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnung des Colepius, balneator oder curator balnei. Separate gemauerte Treppe zum OG (etwa 14 Stufen erhalten).;
Gebäude VII 5, 3
(ID 623)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Fleischerei?).;
Gebäude VII 5, 4
(ID 624)
Fläche: 34 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio di alimentari
Kategorien
Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft.;
Gebäude VII 5, 5
(ID 625)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt.;
Gebäude VII 5, 6
(ID 626)
Fläche: 30 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 5, 9
(ID 627)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Cella
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Thermeneingänge s. o.;
Gebäude VII 5, 11
(ID 628)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 5, 13
(ID 629)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 5, 14
(ID 630)
Fläche: 49 qm
Räume
-
Name(n)
Taberna lactaria di Aemilius Fidelis
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium, popina des Casellius? Taberna lactaria des Aemilius Fidelis.;
Gebäude VII 5, 15
(ID 631)
Fläche: 64 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden eines faber aerarius? (Reparaturen?).;
Gebäude VII 5, 16
(ID 632)
Fläche: 60 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona con thermopolium?
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Gastwirtschaft mit thermopolium?;
Gebäude VII 5, 17
(ID 633)
Fläche: 66 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona di ...nnius
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium und caupona des ...nnius.;
Gebäude VII 5, 18
(ID 635)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Lavanderia?
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wäscherei?;
Gebäude VII 5, 19
(ID 636)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
Lavanderia?
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wäscherei?;
Gebäude VII 5, 20
(ID 637)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 5, 21
(ID 638)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittel?).;
Gebäude VII 5, 22
(ID 639)
Fläche: 39 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt.;
Gebäude VII 5, 23
(ID 640)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega e officina di un faber aerarius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden und Werkstatt eines negotiator und faber aerarius.;
Gebäude VII 5, 25
(ID 642)
Fläche: 34 qm
Räume
-
Name(n)
Officina con bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt mit Laden (Thermenbedarf). Auch officina vitraria?;
Gebäude VII 5, 26
(ID 643)
Fläche: 38 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina (tintoria?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt (Färberei?).;
Gebäude VII 5, 27
(ID 644)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Obst- und Gemüsegeschäft?).;
Gebäude VII 5, 28
(ID 645)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 5, 29
(ID 646)
Fläche: 30 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega; Laden des Acastus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Acastus.;
Gebäude VII 6, 7
(ID 651)
Fläche: 382 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Privathaus.;
Gebäude VII 6, 12
(ID 654)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleiner Laden.;
Gebäude VII 6, 21
(ID 659)
Fläche: 50 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio (di alimentari?)
Kategorien
Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft?;
Gebäude VII 6, 19.20.28
(ID 662)
Fläche: 841 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Secundus Tyrannus Fortunatus (?)
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Secundus Tyrannus Fortunatus (?) mit Laden eines negotiator pigmentarius in 19 und caupona des M. C. N. in 20.;
Gebäude VII 6, 29
(ID 663)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Officina e bottega di un argentiere
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt und Laden eines Feinschmiedes (Bronze- und Eisenwaren) zu 30.;
Gebäude VII 6, 31
(ID 664)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 6, 30.37
(ID 666)
Fläche: 411 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Petutius Quintio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Posticum zu 30.;
Gebäude VII 6, 38
(ID 667)
Fläche: 259 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Cipius Pamphilus Felix
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Cipius Pamphilus Felix.;
Gebäude VII 7, 2.5.14.15
(ID 668)
Fläche: 1290 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Trittolemo; Haus der Cissonii
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Cissonius Secundus, Haus der Cissonii. Wohnung des L. Calpurnius Diogenes procurator mit Frau Gavia Severa und Verwandten (lib.); Casa di Trittolemo; Doppelatriumhaus.;
Gebäude VII 7, 3
(ID 669)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Honig-und Weinverkauf?) des Suilimea (servus der Cissonii?).;
Gebäude VII 7, 6
(ID 670)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden eines arcarius (Bronzegegenstände für Bau- und Tischlerbedarf, Armierung von Möbeln, Türen, Kisten?).;
Gebäude VII 7, 7
(ID 671)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden zu 6? (Knochenschnitzereien).;
Gebäude VII 7, 10.13
(ID 673)
Fläche: 442 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Romulo e Remo
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Fabius H.; Arzthaus? Casa di Romulo e Remo.;
Gebäude VII 7, 16
(ID 675)
Fläche: 211 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del veteranus Julianus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del veteranus Julianus; Haus eines avicularius.;
Gebäude VII 7, 18
(ID 677)
Fläche: 51 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona di L. Numinius
Kategorien
Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona des L. Numinius mit Lupanar.;
Gebäude VII 7, 19
(ID 678)
Fläche: 125 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di un faber gemmarius
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines faber gemmarius.;
Gebäude VII 7, 17.23
(ID 681)
Fläche: 350 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di C. Iulius Primigenius
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Zweigeschossiger angiportus hinter dem Forumsbereich mit separater Treppe zum OG und dem letzten Hauseingang. Haus des C. Julius Primigenius.;
Gebäude VII 7, 24
(ID 682)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 7, 25
(ID 683)
Fläche: 30 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: wie 24. Vorn r. Treppe zum HG?;
Gebäude VII 7, 28
(ID 686)
Fläche: 46 qm
Räume
-
Name(n)
Latrina pubblica
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Öffentliche Latrine am Forum Civile.;
Gebäude VII 7, 29
(ID 687)
Fläche: 291 qm
Räume
-
Name(n)
Foro venale; Granai del Foro
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kaufhalle an der W-Seite des Forum Civile (Getreide, Obst, Gemüse?); Foro venale. Schule.;
Gebäude VII 7, 30
(ID 688)
Fläche: 495 qm
Räume
-
Name(n)
Scuola
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Schule.;
Gebäude VII 7, 31.32.34.35
(ID 689)
Fläche: 1858 qm
Räume
-
Name(n)
Apollon-Bezirk; Tempio di Apollo
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Apollon-Bezirk.;
Gebäude VII 7, 33
(ID 690)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Mensa ponderaria
Kategorien
Heiligtum, Altar
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: mensa ponderaria. Flache Mauernische in der O-Wand des Tempels mit Trav. Tisch ( + ) (Nachbildung);
Gebäude VII 8, 1
(ID 691)
Fläche: 486 qm
Räume
-
Name(n)
Tempel der Kapitolinischen Trias; Tempio di Giove
Kategorien
Heiligtum; Heiligtum, Altar
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Kapitol; Tempel der Kapitolinischen Trias; Templum Iovis opt. max.;
Gebäude VII 9, 1.43.66.67.68
(ID 692)
Fläche: 2502 qm
Räume
1, 10, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 9
Name(n)
Edificio di Eumachia; Gebäude der Eumachia L. f.
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Gebäude der Eumachia L. f., sacerdos publica: chalcidicum, crypta, porticus.;
Gebäude VII 9, 4
(ID 695)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Sacellum Larum publicorum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Larenkapelle mit Podium. L. vom Eingang Statuenbasis zu 5.;
Gebäude VII 9, 5
(ID 696)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Taberna
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna argentaria, offener Laden mit Schwelle.;
Gebäude VII 9, 6
(ID 697)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Taberna
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna argentaria (s. o.).;
Gebäude VII 9, 7.8.19.42
(ID 698)
Fläche: 1589 qm
Räume
1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, g, h, i
Name(n)
Macellum
Kategorien
Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Macellum. Fleisch-, Fisch- und Lebensmittelmarkt.;
Gebäude VII 9, 9
(ID 699)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Taberna
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna argentaria.;
Gebäude VII 9, 10
(ID 700)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 9, 11
(ID 701)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Taberna
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna argentaria (des Cornelius)?;
Gebäude VII 9, 12
(ID 702)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Quintus?;
Gebäude VII 9, 13
(ID 703)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Sodalicium dei unguentari
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Sodalicium der unguentari im OG von 11.12.;
Gebäude VII 9, 14
(ID 704)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft).;
Gebäude VII 9, 15
(ID 705)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega di Similis
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Similis. Lebensmittelgeschäft.;
Gebäude VII 9, 16
(ID 706)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega di Piaulis (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Piaulis? taberna vitrea.;
Gebäude VII 9, 20
(ID 709)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelverkauf).;
Gebäude VII 9, 21
(ID 710)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden, Lebensmittelverkauf?;
Gebäude VII 9, 22
(ID 711)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium, Schnellimbiß?;
Gebäude VII 9, 23
(ID 712)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelverkauf?).;
Gebäude VII 9, 24
(ID 713)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Schmaler Laden (Lebensmittelverkauf?).;
Gebäude VII 9, 25
(ID 714)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelverkauf?).;
Gebäude VII 9, 26
(ID 715)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelverkauf?).;
Gebäude VII 9, 28
(ID 717)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden. Taberna olearia? Lebensmittelgeschäft?;
Gebäude VII 9, 29.30.31.32.33.34
(ID 718)
Fläche: 219 qm
Räume
1, 1-29, 2, 2-29, 3, 3-30, 4, 4-30, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa del Re di Prussia; Thermopolium und caupona des Donatus und Verpus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium und caupona des Donatus und Verpus. Casa del Re di Prussia.;
Gebäude VII 9, 44
(ID 723)
Fläche: 43 qm
Räume
-
Name(n)
Officina lanifricaria
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Officina lanifricaria.;
Gebäude VII 9, 47.48.51.65
(ID 725)
Fläche: 762 qm
Räume
1, 1-48, 1-51, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa delle nozze d'Ercole; Casa delle Nozze di Ercole ed Ebe; Casa dello sposalizio di Ercole; Casa di Marte e Venere
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Flamen (sacerdos) luventutis Pompeianae; Casa delle Nozze di Ercole ed Ebe; Casa dello sposalizio di Ercole; Casa di Marte e Venere.;
Gebäude VII 9, 49
(ID 726)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelverkauf).;
Gebäude VII 9, 50
(ID 727)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden mit gemauertem Podium (x).;
Gebäude VII 9, 52
(ID 729)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Scala
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG von 47.;
Gebäude VII 9, 58
(ID 731)
Fläche: 70 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega con officina (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden mit Werkstatt?;
Gebäude VII 9, 59
(ID 732)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 9, 64
(ID 735)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Scala
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Enges Treppenhaus.;
Gebäude VII 10, 4
(ID 740)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 10, 6
(ID 742)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 10, 7
(ID 744)
Fläche: 94 qm
Räume
-
Name(n)
[Rovina]
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Erdbebenruine, im Wiederaufbau begriffen? N-Wand: Bild Satyr-Nymphe (+).;
Gebäude VII 11, 1
(ID 748)
Fläche: 203 qm
Räume
-
Name(n)
Seminarium
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Gärtnerei oder seminarium in Erdhebenruine.;
Gebäude VII 11, 11.14
(ID 753)
Fläche: 728 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, y
Name(n)
Ebreo Albergo; Hospitium Christianorum
Kategorien
Atriumhaus; Gastronomie; Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ebreo Albergo. Hospitium Christianorum.;
Gebäude VII 11, 13
(ID 754)
Fläche: 28 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona
Kategorien
Gastronomie
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: An der Fassade Straßenheiligtum.;
Gebäude VII 11, 15
(ID 756)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelschäft?).;
Gebäude VII 12, 3.4
(ID 758)
Fläche: 386 qm
Räume
1, a, a', b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, r'
Name(n)
Casa del Principe Enrico di Olanda; Casa di L. Caecilius Capella
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Caecilius Capella; Casa del Principe Enrico di Olanda.;
Gebäude VII 12, 5
(ID 759)
Fläche: 65 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega di Rutellius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Rutellius (Rutullius).;
Gebäude VII 12, 6
(ID 760)
Fläche: 38 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 12, 7
(ID 761)
Fläche: 131 qm
Räume
-
Name(n)
Pistrinum e bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: pistrinum und Laden eines pistor dulciarius.;
Gebäude VII 12, 10
(ID 763)
Fläche: 149 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega e officina di Festus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden und officina des Festus.;
Gebäude VII 12, 11
(ID 764)
Fläche: 172 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Forno
Kategorien
Bäckerei; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Laden; Casa del Forno; ehemalige Großbäckerei. Erdbebengrundstück eines pistrinum, 79 n. Chr. im Neubau oder in Umwandlung begriffen.;
Gebäude VII 12, 12
(ID 765)
Fläche: 76 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con bottega (e caupona?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus, Schenke (?) mit Laden.;
Gebäude VII 12, 13
(ID 766)
Fläche: 151 qm
Räume
-
Name(n)
Panificium e caupona
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Panificium und caupona des Sabinus mit Laden.;
Gebäude VII 12, 14
(ID 767)
Fläche: 138 qm
Räume
-
Name(n)
Ludus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lehranstalt für etwa 30 Schüler der LL. Cornelii Amandus und Proculus; Grammatik-Schule.;
Gebäude VII 12, 18.19.20
(ID 770)
Fläche: 56 qm
Räume
-
Name(n)
Lupanare di Africanus e Victor
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Lupanar des Africanus mit puer Rusticus (servus Africani), fornax.;
Gebäude VII 12, 28
(ID 774)
Fläche: 253 qm
Räume
1, a, b, c, d, e, f, f', g, h, i, k, l, m, n, o, o', p
Name(n)
Casa del Balcone pensile
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Balcone pensile.;
Gebäude VII 12, 33
(ID 781)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Cella meretricia
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: cella meretricia.;
Gebäude VII 13, 2
(ID 784)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleiner Laden.;
Gebäude VII 13, 3.4.16.17.18
(ID 785)
Fläche: 498 qm
Räume
1, a, a-4, b, c, d, e, f, f', p, q, r, s, t, u, v, z
Name(n)
Casa delle quattro stagioni; Casa di Ganimede; Haus des Königs von Preußen
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa di Ganimede; Casa delle quattro stagioni; Haus des Königs von Preußen.;
Gebäude VII 13, 5
(ID 786)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 13, 6
(ID 794)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 13, 7
(ID 795)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con officina infectoria
Kategorien
Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Handwerkerhaus mit officina infectoria.;
Gebäude VII 13, 8.14
(ID 796)
Fläche: 425 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di L. Caecilius Communis (?)
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Caecilius Communis (?) oder Haus des M. Stronnius Favorinus?;
Gebäude VII 13, 13
(ID 799)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Lupanare (?)
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnung im OG (Lupanar?).;
Gebäude VII 13, 15
(ID 801)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Cella meretricia
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: cella meretricia.;
Gebäude VII 13, 16
(ID 802)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Cella meretricia
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: cella meretricia.;
Gebäude VII 13, 22
(ID 806)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Haushaltswaren?).;
Gebäude VII 13, 23
(ID 807)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Kunstgewerbe).;
Gebäude VII 13, 24
(ID 808)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium di Suettius Certus?
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium des Suettius Certus?;
Gebäude VII 14, 2
(ID 810)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelverkauf?).;
Gebäude VII 14, 3
(ID 811)
Fläche: 46 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Gemüsegeschäft?).;
Gebäude VII 14, 4
(ID 812)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Latrina
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG, darunter öffentliche Latrine?;
Gebäude VII 14, 5.17.18.19
(ID 813)
Fläche: 657 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b
Name(n)
Casa del banchiere; Casa del Cambio; Casa della Regina d'Inghilterra
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Cambio; Casa del Banchiere; Casa della Regina d'Inghilterra mit officina tinctoria.;
Gebäude VII 14, 8
(ID 815)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 14, 9
(ID 816)
Fläche: 568 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a
Name(n)
Casa delle Colombe; Casa di V. Popidius; Haus des Herzogs von Sachsen
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der gens Popidia? Casa di V. Popidius; Casa delle Colombe; Haus des Herzogs von Sachsen.;
Gebäude VII 14, 10
(ID 817)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 14, 11
(ID 818)
Fläche: 16 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 14, 12
(ID 819)
Fläche: 39 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 14, 13
(ID 820)
Fläche: 28 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 14, 14.15.16
(ID 821)
Fläche: 320 qm
Räume
1, 1-14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2-14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di L. Caecilius Communis (?)
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Caecilius Communis (?) oder Haus des M. Stronnius Favorinus? Ölherstellung und -verkauf.;
Gebäude VII 15, 1.2.15
(ID 822)
Fläche: 1182 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Niobidi; Casa del Gallo; Casa di Marinaio; Casa di Niobe; Haus der Großherzogin Olga von Rußland
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Doppelhaus (samn. des Maius Castricius) vor 79 n. Chr.; Haus des Schiffseigners (?) C. Lollius Fuscus; Casa di Niobe; Casa dei Niobidi; Casa del Gallo; Casa di Marinaio; Haus der Großherzogin Olga von Rußland.;
Gebäude VII 15, 3
(ID 823)
Fläche: 195 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines Kunsthändlers?;
Gebäude VII 15, 8
(ID 826)
Fläche: 179 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Heracla und Aegle
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus von Heracla und Aegle.;
Gebäude VII 15, 11a.11
(ID 828)
Fläche: 142 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Verus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Verus mit servi Restituta und Secundus.;
Gebäude VII 16, 1
(ID 831)
Fläche: 543 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großes Hanghaus über der Stadtmauer.;
Gebäude VII 16, 2
(ID 832)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Imbißstube?).;
Gebäude VII 16, 9
(ID 836)
Fläche: 48 qm
Räume
-
Name(n)
Pistrinum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines pistrinum.;
Gebäude VII 16, 12.13.14.15.16
(ID 838)
Fläche: 2266 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della gens Umbricia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohn- und Handelshaus der gens Umbricia; Haus des M. Umbricius Scaurus, Vater und Sohn, Produzenten und Händler von garum (Fabrik in I 12, 8); 13 ehemals samn. Haus des Maras Spurnius, Stadtkommandant gegen Sulla, mit Praetorium.;
Gebäude VII 16, 18
(ID 840)
Fläche: 64 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Handwerkerhaus (?) zu 20?;
Gebäude VII 16, 19
(ID 841)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Officina (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Einräumige Werkstatt (?) zu 20?; SLuecke: PIP (https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%2016%2019.htm) behaupten: "Unnumbered on Eschebach site plan.";
Gebäude VIII 1, 1.2.6
(ID 843)
Fläche: 1600 qm
Räume
-
Name(n)
Basilica
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Basilika.;
Gebäude VIII 1, 3.5
(ID 844)
Fläche: 4370 qm
Räume
1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7
Name(n)
Tempel der Venus fisica pompeiana; Tempel der Venus Pompeiana; Tempio di Venere
Kategorien
Heiligtum; Heiligtum, Altar
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Tempel der Venus Pompeiana; Tempel der Venus fisica pompeiana.;
Gebäude VIII 2, 0
(ID 846)
Fläche: 1005 qm
Räume
-
Name(n)
Casa sannitica
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Samn. Haus zwischen dem (modernen) Antiquarium (VIII 1, 4) und VIII 2, 1.;
Gebäude VIII 2, 13
(ID 850)
Fläche: 360 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus.;
Gebäude VIII 2, 14.15.16.18.19.20
(ID 851)
Fläche: 3636 qm
Räume
-
Name(n)
Casa a cinque piani
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Gebäudekomplex des L. Aelius Magnus. Eine aus samn. Atriumhäusern, Höfen und Hanggeschossen mit Terrassen zusammengestellte Großvilla am Stadtrand (Südhang), aufgeteilt in Mietwohnungen und Thermen. Casa a cinque piani (über 100 Räume). Besitzerin oder Pächterin des 2. UG von 17 und 23 (?): Dicidia Margaris (siehe unter 23).;
Gebäude VIII 2, 15
(ID 852)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Kosmetika?).;
Gebäude VIII 2, 21
(ID 853)
Fläche: 601 qm
Räume
al1, G1, G2, G3, H, I, I', L, M, N, O
Name(n)
Bottega di L. Aelius Magnus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Aelius Magnus.;
Gebäude VIII 2, 22.23.24
(ID 854)
Fläche: 659 qm
Räume
a, b, e, e', F, g, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t
Name(n)
Palaestra und balneum der Dicidia Margaris; Palestra di Via delle Scuole; Palestra sannitica
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Palästra mit Männerbad; Palestra di Via delle Scuole; Vornehmes Privatbad; Palaestra und balneum der Dicidia Margaris (Eigentümerin, Pächterin oder Verwalterin beider Bäder in 17 und 23?). ;
Gebäude VIII 2, 25
(ID 855)
Fläche: 1 qm
Räume
-
Name(n)
Altare
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Straßenaltar.;
Gebäude VIII 2, 26.27
(ID 856)
Fläche: 490 qm
Räume
111, 11s1, 21l, 2a1, 2b1, 31l, 41l, 51l, 61l, a, b, c, c', d, d1, e, f, g, h, h1, h2, m, n, p, q
Name(n)
Casa del Cinghiale II
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des ? und des Vesbinus; Casa del Cinghiale II.;
Gebäude VIII 2, 28
(ID 857)
Fläche: 485 qm
Räume
a, c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, p, q, r, s
Name(n)
Casa col ninfeo; Haus mit dem Nymphäum
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus mit dem Nymphäum.;
Gebäude VIII 2, 29.30
(ID 858)
Fläche: 1340 qm
Räume
1, 29, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, k', l, m', n, o, p, q, r, s, u, v, w, x, y, z
Name(n)
Casa di Giuseppe II; Haus des Severus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Severus (Schauspieler oder Theaterliebhaber?). Doppelatriumhaus. Westlich von 30 komische Maske aus Terrakotta in die Fassade eingelassen. Casa di Giuseppe II.;
Gebäude VIII 2, 31
(ID 859)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 2, 35
(ID 861)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 2, 38.39
(ID 863)
Fläche: 947 qm
Räume
a, al2, b, bl2, c, d, e, f, g, gl2, h, i, k, l, m, n, ns1, o, p, q, r, s, t, u, v, w
Name(n)
Casa dell'Imperatore Giuseppe II.; Casa di Fusco; Haus der gens Tullia (?)
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der gens Tullia (?); Casa di Fusco; Casa dell'Imperatore Giuseppe II.;
Gebäude VIII 3, 2
(ID 865)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden, mit Schule des Verna(7).;
Gebäude VIII 3, 3
(ID 866)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 3, 4.6
(ID 867)
Fläche: 783 qm
Räume
1, 1-6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di Ercole ed Auge; Haus der Popidii
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Popidii; Casa di Ercole ed Auge.;
Gebäude VIII 3, 5
(ID 868)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden eines faber oder negotiator aerarius?;
Gebäude VIII 3, 7
(ID 869)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 3, 8
(ID 870)
Fläche: 719 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vestibolo
Name(n)
Casa del Cinghiale I; Haus der LL. Coelii, Caldus und Postumus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der LL. Coelii, Caldus und Postumus (Nachkommen des röm. Generals L. Coelius Caldus, Praetor in Spanien und röm. Konsul?); Casa del Cinghiale I.;
Gebäude VIII 3, 9
(ID 871)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega; Laden des aurifex Anteros (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des aurifex Anteros (?) mit Sitz des collegium aurificium.;
Gebäude VIII 3, 10.11.12
(ID 872)
Fläche: 119 qm
Räume
-
Name(n)
Casa delle Grazie
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des medicus A. Pomponius Magonianus und des Pomponius Severus; Casa delle Grazie mit Klinik und Behandlungsraum (Laden, Apotheke).;
Gebäude VIII 3, 13
(ID 873)
Fläche: 66 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine Wohnung.;
Gebäude VIII 3, 14.15
(ID 874)
Fläche: 1026 qm
Räume
-
Name(n)
Casa d'Adonide; Casa della Regina Carolina; Haus mit dem Sigma
Kategorien
Atriumhaus; Garten; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa d'Adonide; vorher: Casa della Regina Carolina (Murat). Haus mit dem Sigma. Gartenrestaurant mit großer Küche und Garten.;
Gebäude VIII 3, 15
(ID 875)
Fläche: 142 qm
Räume
-
Name(n)
Popina
Kategorien
Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: popina.;
Gebäude VIII 3, 19
(ID 877)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 3, 22
(ID 879)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 3, 23
(ID 880)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 3, 24
(ID 881)
Fläche: 524 qm
Räume
-
Name(n)
Casa d'Apolline e Coronide; Haus der Plotilla
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Plotilla; Casa d 'Apolline e Coronide. Hofhaus.;
Gebäude VIII 3, 25
(ID 882)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 3, 26
(ID 883)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Officina (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine Werkstatt?;
Gebäude VIII 3, 27
(ID 884)
Fläche: 284 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Privathaus (Hofhaus).;
Gebäude VIII 3, 29
(ID 886)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium (?)
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium?;
Gebäude VIII 4, 2.3.4.5.6.49.50
(ID 890)
Fläche: 754 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 17, 2, 22, 23, 23a, 23b, 23c, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di Diana; Haus der QQ. Postumii
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der QQ. Postumii, Modestus und Proculus und der Blaesia Prima, Frau des Modestus, und servi Heracla, Sagata; Casa di Diana.;
Gebäude VIII 4, 7
(ID 891)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Severus.;
Gebäude VIII 4, 8.9
(ID 892)
Fläche: 615 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x
Name(n)
Casa di T. Mescinius Gelo
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des T. Mescinius Gelo mit Laden des Januarius mit M. Amullius Cosmus (?), Verkäufer Phoebus (?);
Gebäude VIII 4, 10
(ID 893)
Fläche: 27 qm
Räume
1, 2, a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden. Taberna pigmentaria.;
Gebäude VIII 4, 11
(ID 894)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Fabbrica di Colori
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt eines negoliator pigmentarius. Fabbrica di Colori.;
Gebäude VIII 4, 12
(ID 895)
Fläche: 364 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, r'
Name(n)
Ganeum Lupanare; Ganeum-Lupanar
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ganeum-Lupanar, verborgen hinter 2 Läden: caupona zu den Stabianer Thermen mit Barbierladen.;
Gebäude VIII 4, 13
(ID 896)
Fläche: 20 qm
Räume
s
Name(n)
Tonstrina
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Tonstrina.;
Gebäude VIII 4, 14.15.16.22.23.30
(ID 897)
Fläche: 967 qm
Räume
1, 1-23, 2, 23, 3, 30, 4, 5, 6, a, a-30, b, b-30, c, c-30, d, e, f, g, g-30, h, i, j, k, m, n, n', n'', n''', o, r, s, t, u, v, x, y, z
Name(n)
Casa di C. Cornelius Rufus; Domus Cornelia
Kategorien
Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Samus mit Nymphen
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der CC. Cornelii, Rufus, Ver, Adiutor und Fuscus (hoher Militär); Domus Cornelia.;
Gebäude VIII 4, 19
(ID 899)
Fläche: 40 qm
Räume
a, b, c, d
Name(n)
Popina
Kategorien
Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Popina zu 15?;
Gebäude VIII 4, 20
(ID 900)
Fläche: 38 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Bottega e officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt und Laden eines Steinschneiders.;
Gebäude VIII 4, 21
(ID 901)
Fläche: 28 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Terrakottageschirr).;
Gebäude VIII 4, 24
(ID 903)
Fläche: 10 qm
Räume
b
Name(n)
Sacello dei Lares compitales
Kategorien
Heiligtum, Altar
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Sacellum der Lares Compitales.;
Gebäude VIII 4, 25
(ID 904)
Fläche: 40 qm
Räume
1, a
Name(n)
Bottega
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Kunstgewerbe), auch caupona?;
Gebäude VIII 4, 26.27.29
(ID 905)
Fläche: 348 qm
Räume
1, 1a, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, m', n, o, r
Name(n)
Bottega (pistrinum di Felix lib.)
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und pistrinum des Felix lib. (der gens Cornelia?) mit 2 Läden.;
Gebäude VIII 4, 34
(ID 908)
Fläche: 290 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Name(n)
Casa con Atrio tetrastilo; Casa di Omfale
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa di Omfale; Casa con Atrio tetrastilo.;
Gebäude VIII 4, 35
(ID 909)
Fläche: 31 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft).;
Gebäude VIII 4, 36
(ID 910)
Fläche: 33 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden (Lebensmittel?).;
Gebäude VIII 4, 37
(ID 911)
Fläche: 104 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h
Name(n)
Casa con officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Reihenhaus mit Werkstatt (Schmiede)?;
Gebäude VIII 4, 38
(ID 912)
Fläche: 17 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Verkauf der Erzeugnisse der Werkstatt 37?).;
Gebäude VIII 4, 39
(ID 913)
Fläche: 53 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus mit Laden.;
Gebäude VIII 4, 41
(ID 915)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Latrina
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Öffentliche Latrine (zu 42?).;
Gebäude VIII 4, 42
(ID 916)
Fläche: 33 qm
Räume
1, a, b
Name(n)
Stalla
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Stall mit Krippe und Viehtränke. ;
Gebäude VIII 4, 45
(ID 918)
Fläche: 50 qm
Räume
a, b, c, d, e
Name(n)
Taberna vinaria
Kategorien
Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna vinaria. Weinhandlung und -Ausschank.;
Gebäude VIII 4, 46
(ID 919)
Fläche: 23 qm
Räume
1, 2, 3
Name(n)
Studio medico
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Arztpraxis (eines Alexandriners?).;
Gebäude VIII 4, 47
(ID 920)
Fläche: 33 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden (Lebensmittelverkauf).;
Gebäude VIII 4, 48
(ID 921)
Fläche: 30 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Forgia (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Schmiede?;
Gebäude VIII 5, 2.3.5
(ID 925)
Fläche: 1257 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, f', f'', f''', f'''', g, h, h', i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, u', v, w, x, y, z
Name(n)
Casa del gallo
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Doppelatriumhaus (der osk. gens Aadirans?).;
Gebäude VIII 5, 4
(ID 926)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 5, 6
(ID 927)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 5, 7
(ID 928)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden.;
Gebäude VIII 5, 8.9.11.12.13.14
(ID 929)
Fläche: 618 qm
Räume
1, 1-10, 1-11, 1-8, 2, 3, 4, 5, 7, 7a, 8, 9, a, b, c, d, e, f, g, h, h', h'', h''', i, j, k, l, m, n, o, p, q
Name(n)
Casa di un grossista di ceramiche
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Atriumhaus eines Keramik-Großhändlers (mit hauseigenen Läden).;
Gebäude VIII 5, 10
(ID 930)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft? Erfrischungsgetränke?).;
Gebäude VIII 5, 21
(ID 935)
Fläche: 47 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude VIII 5, 24.25.26
(ID 937)
Fläche: 270 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Giudizio di Salomone; Casa del Medico nuovo I
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines jüdisch-alexandrinischen Arztes mit Klinik; Casa del Medico nuovo I; Casa del Giudizio di Salomone.;
Gebäude VIII 5, 27
(ID 938)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 5, 28.29.34.35
(ID 939)
Fläche: 692 qm
Räume
1, 1-29, 10, 10-36, 11, 11-36, 11a, 11b, 11c, 11d, 12, 12-36, 13-36, 13-36a, 14-36, 15-36, 16-36, 17-36, 18-36, 19-36, 19-36a, 19-36b, 19-36c, 19-36d, 19-36e, 2, 2-36, 2-36', 20-36, 21-36, 3, 4, 5, 6, 6-36, 6-36a, 6-36b, 7, 7-36, 7-36a, 7-36b, 7-36c, 7-36d, 8, 8-36, 8-36a, 9, b
Name(n)
Casa dell'Imperatore Francesco I di Austria; Casa delle Calce
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa delle Calce; Casa dell' Imperatore Francesco I di Austria.;
Gebäude VIII 5, 32
(ID 941)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 5, 33
(ID 942)
Fläche: 21 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VIII 5, 36
(ID 944)
Fläche: 733 qm
Räume
-
Name(n)
Samnitische Thermena; Terme repubblicane
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ehemaliges posticum zu einer Erdbebenruine, 79 n. Chr. hortus mit Gärtnerwohnung (im Besitz von 28?). ; Eschebach 1993: Ehemals Thermen. Nach Zerstörung durch Erdbeben Gartengrundstück;
Gebäude VIII 5, 37
(ID 945)
Fläche: 423 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Parete rossa; Casa delle Pareti rosse; Haus der gens Fabia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der gens Fabia; Casa delle Pareti rosse; Casa della Parete rossa.;
Gebäude VIII 5, 39
(ID 947)
Fläche: 176 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Acceptus e Euhodia
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Acceptus und der Euhodia (Alexandriner); Klinik für Geburtshilfe.;
Gebäude VIII 6, 3
(ID 950)
Fläche: 218 qm
Räume
-
Name(n)
Proprietà in macerie (usato come giardino?)
Kategorien
Garten; Trümmergrundstück
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Abbruchgrundstück, als Garten genutzt?;
Gebäude VIII 6, 4
(ID 951)
Fläche: 384 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus mit atrium polistylum.;
Gebäude VIII 6, 5
(ID 952)
Fläche: 158 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus.;
Gebäude VIII 6, 6
(ID 953)
Fläche: 1006 qm
Räume
-
Name(n)
Proprietà in macerie
Kategorien
Trümmergrundstück
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Gärtnerei über Abrißgrundstück.;
Gebäude VIII 6, 7
(ID 954)
Fläche: 131 qm
Räume
-
Name(n)
Proprietà in macerie
Kategorien
Atriumhaus; Garten; Trümmergrundstück
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Abbruchhaus (Garten?).;
Gebäude VIII 7, 5.6.7.8
(ID 956)
Fläche: 464 qm
Räume
a, a-5, b, b-5, c, c-5, d, e, f, f', g, g', h, h', i, i', k, l, l', m, n, o
Name(n)
Officina; Werkstätten des M. Surus (Syrus) Garasenus
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstätten des M. Surus (Syrus) Garasenus.;
Gebäude VIII 7, 16.17
(ID 958)
Fläche: 3862 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19a, 19b, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 64a, 64b, 64c, 64d, 65, 7, 8, 9
Name(n)
Caserma dei gladiatori; Ludus gladiatorius; Quadriportico dei Teatri
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: quadriporticus der Theater, n. Erdb. ludus gladiatorius.;
Gebäude VIII 7, 17.18.19.20
(ID 959)
Fläche: 886 qm
Räume
1, 10a, 10b, 2, 2b, 3, 3_1, 3_3, 4, 5b, 5d, 5f, 5h, 5l, 6a, 8, 9a, 9a_1, 9a_2, 9b, 9b_1, 9b_2
Name(n)
Kleines Theater; Odeion; Theatrum tectum
Kategorien
Theater
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Theater; theatrum tectum; Odeon.;
Gebäude VIII 7, 20.21.27.30
(ID 960)
Fläche: 4252 qm
Räume
1, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 39a, 39b, 3a, 3b, 4, 40, 41, 5, 6, 7a, 7c, 7e, 7g, 7i, 7m, 7o
Name(n)
Großes Theater; Teatro grande; Teatro tragico
Kategorien
Theater
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Großes Theater; Teatro tragico.;
Gebäude VIII 7, 22.23.24
(ID 961)
Fläche: 508 qm
Räume
1, 1-22, 1-22S1, 1-23, 10, 11, 1a-23, 2, 2-23, 3, 4, 4-23, 5, 8, 9
Name(n)
Casa dello scultore
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa dello Scultore. Officina und domus eines sculptor oder marmorarius. Officina marmoraria o statuaria. ;
Gebäude VIII 7, 25
(ID 962)
Fläche: 151 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5, 6
Name(n)
Tempel des Asclepius; Tempel des Zeus Meilichios; Tempio della Triade Capitolina
Kategorien
Heiligtum; Heiligtum, Altar
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Tempel des Zeus Meilichios; n. Erdb.: Tempio della Triade Capitolina.;
Gebäude VIII 7, 27.28
(ID 963)
Fläche: 592 qm
Räume
1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4, 4_1, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Iseum; Isistempel; Tempio d'Iside
Kategorien
Heiligtum; Heiligtum, Altar
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Isis-Tempel, Iseum.;
Gebäude VIII 7, 29
(ID 964)
Fläche: 477 qm
Räume
1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6
Name(n)
Curia Isiaca; Palästra der Knaben?; Palestra sannitica; Samnitische Palästra der Vereiia Pumpaiiana
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Samnitische Palästra der Vereiia Pumpaiiana; Palästra der Knaben? Curia lsiaca.;
Gebäude VIII 7, 31
(ID 965)
Fläche: 462 qm
Räume
10a, 10b, 9a, 9b, 9c, 9d
Name(n)
Forum triangolare; Tempio dorico (prima dedicato a Herakles, poi a Minerva)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Zugang zum Forum Triangulare.;
Gebäude IX 1, 2
(ID 966)
Fläche: 21 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Farbenhandlung).;
Gebäude IX 1, 4
(ID 968)
Fläche: 28 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Feine Bronze- und Eisenarbeiten)?;
Gebäude IX 1, 5
(ID 969)
Fläche: 177 qm
Räume
a, b, c, d, e
Name(n)
Officina di L. Livius Firmus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt des L. Livius Firmus, faber ferrarius? negotiator ferrarius? structor?;
Gebäude IX 1, 6
(ID 970)
Fläche: 48 qm
Räume
a, b
Name(n)
Thermopolium, popina
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium, popina.;
Gebäude IX 1, 7
(ID 971)
Fläche: 180 qm
Räume
a, c, d, e, f, g, h, h', i, i'
Name(n)
Casa di Paccius Alexander
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus des Paccius Alexander (Juwelier?).;
Gebäude IX 1, 9
(ID 972)
Fläche: 28 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Fabritius (Metallwaren)?;
Gebäude IX 1, 12
(ID 974)
Fläche: 234 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, h", h"", i, k, l, m, n, o, p
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Atriumhaus.;
Gebäude IX 1, 13
(ID 975)
Fläche: 14 qm
Räume
1
Name(n)
Thermopolium, popina
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium, caupona.;
Gebäude IX 1, 14
(ID 976)
Fläche: 9 qm
Räume
1
Name(n)
Officina e bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt und Laden (Steinarbeiten?).;
Gebäude IX 1, 17.18.19
(ID 978)
Fläche: 135 qm
Räume
1, 1-17, 1-19, a, b, c, d, e, f, g, h, h', h'''', i
Name(n)
Casa di Lollia Successa
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus der Lollia Successa mit Werkstatt und Läden (Anfertigung von Holzkästen, Verkauf von Terrakottawaren).;
Gebäude IX 1, 20.30
(ID 979)
Fläche: 891 qm
Räume
b, b', c, c', c'', c''', c'''', d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, u', v, v', w, x, x', y, z
Name(n)
Casa dei MM. Epidii Rufus e Sabinus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der MM. Epidii Rufus und Sabinus.;
Gebäude IX 1, 22.29
(ID 980)
Fläche: 933 qm
Räume
a, a', b, b', c, c', d, e, e', f, f', g, g', h, h', h'', i, i', k, k', l, m, m', m'', m''', m'''', n, n', o, p, q, r, s1, s2, s3, t, t', u, v, w, x, y, y', y'', y''', z
Name(n)
Casa del Parnasso; Doppelhaus der CC. Cuspii, Pansa und Proculus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Doppelhaus der CC. Cuspii, Pansa und Proculus; Casa del Parnasso.;
Gebäude IX 1, 23
(ID 981)
Fläche: 14 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Metallwaren).;
Gebäude IX 1, 24
(ID 982)
Fläche: 27 qm
Räume
c, c'
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Baugeschäft?).;
Gebäude IX 1, 27
(ID 984)
Fläche: 25 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega; Laden des Pacuvius Erasistratus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel; Stall
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Pacuvius Erasistratus. (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude IX 2, 1
(ID 989)
Fläche: 7 qm
Räume
1
Name(n)
Portico
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: porticus (Arkaden) am quadrivium. 3 Arkaden (op. test. auf Lavasockeln) tragen das OG.;
Gebäude IX 2, 2
(ID 990)
Fläche: 27 qm
Räume
1
Name(n)
Casa (con bottega?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Werkstatt? (Knochenschnitzer?).;
Gebäude IX 2, 3
(ID 991)
Fläche: 26 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega; Taberna degli Attii
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden. Taberna degli Attii.;
Gebäude IX 2, 4
(ID 992)
Fläche: 103 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g
Name(n)
Casa con officina e bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Werkstatt und Laden.;
Gebäude IX 2, 5
(ID 993)
Fläche: 129 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h
Name(n)
Casa con officina e bottega; Casa di Arianna abbandonata
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Laden und Werkstatt (Juwelier); Casa di Arianna abbandonata.;
Gebäude IX 2, 6
(ID 994)
Fläche: 41 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Bottega; Laden und Wohnung (des Hilario?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden und Wohnung des Hilario? (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude IX 2, 7.8
(ID 995)
Fläche: 140 qm
Räume
1, a, b, c, d, e, f, h, h', i, k
Name(n)
Casa della Fontana d'Amore; Geschäftshaus (des Hilario?)
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Handel und Gewerbe; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus des Hilario? Lupanar? Casa della Fontana d'Amore.;
Gebäude IX 2, 9
(ID 996)
Fläche: 38 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude IX 2, 10
(ID 997)
Fläche: 291 qm
Räume
a, b, b', c, d, e, f, g, h, i, k, m, n, o, p
Name(n)
Casa del Gallo II; Casa di Chlorus e Caprasia
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Chlorus und der Caprasia; Casa del Gallo II.;
Gebäude IX 2, 11
(ID 998)
Fläche: 31 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega del Pittore; Taberna degli Attii, pigmentari
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Taberna Attiorum I; taberna pigmentaria; Bottega del Pittore.;
Gebäude IX 2, 12
(ID 999)
Fläche: 66 qm
Räume
c, d, e, g, h
Name(n)
Officina pigmentaria; Taberna II Attiorum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: officina pigmentaria Attiorum; Taberna Attiorum II.;
Gebäude IX 2, 13
(ID 1000)
Fläche: 23 qm
Räume
a, b
Name(n)
Appartamento (?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine Wohnung der Arbeiter zu 11/12 (?) (Fructus, Inventus mit Thalamus).;
Gebäude IX 2, 14
(ID 1001)
Fläche: 44 qm
Räume
l
Name(n)
Proprietà in macerie
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Erdbebenruine, n. Erdb. abgetrennt von 10. Werkstatt oder Schuppen zu 13?;
Gebäude IX 2, 15.16
(ID 1002)
Fläche: 309 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, q', r, r', s, t
Name(n)
Casa della Principessa Margherita; Casa di Bellerofonte; Haus des T. Dentatius Panthera
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des T. Dentatius Panthera. Casa di Bellerofonte; Casa della Principessa Margherita.;
Gebäude IX 2, 17
(ID 1003)
Fläche: 308 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, h', h'', i, k, l, m
Name(n)
Casa di Q. Bri(u)ttius Balbus (?)
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Q. Bri(u)ttius Balbus?;
Gebäude IX 2, 18
(ID 1004)
Fläche: 276 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, h', h'', i, k, m, n, o, t
Name(n)
Casa di Curvius Marcellus e Fabia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des negotiator (?) Curvius Marcellus und der Fabia.;
Gebäude IX 2, 22
(ID 1007)
Fläche: 32 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Haushaltswaren und Reparaturen).;
Gebäude IX 2, 23
(ID 1008)
Fläche: 37 qm
Räume
a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Kunsthandlung).;
Gebäude IX 2, 24
(ID 1009)
Fläche: 165 qm
Räume
a, a', b, c, c', d, e, f, f', g, h
Name(n)
Stalla
Kategorien
Stall
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: stabulum und scuderia.;
Gebäude IX 2, 25
(ID 1010)
Fläche: 37 qm
Räume
a, b
Name(n)
Caupona di Thyrsus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona des Thyrsus und Verkauf von Metallwaren (des Zosimus?) zu 26?;
Gebäude IX 2, 26
(ID 1011)
Fläche: 346 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p
Name(n)
Casa di M. Casellius Marcellus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Casellius Marcellus mit servus Zosimus.;
Gebäude IX 2, 27.28
(ID 1012)
Fläche: 185 qm
Räume
a, b, b', c, d, e, e', f, g, h, i, i', k
Name(n)
Casa della Principessa Margherita; Casa delle nozze di Nettuno e Anfitrite; Haus und Werkstatt des Stukkateurs Antiochus (?)
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und Werkstatt des Stukkateurs Antiochus (?) domus tectoris (tector o architetto di stucchi); Casa delle nozze di Nettuno e Anfitrite; Casa della Principessa Margherita.;
Gebäude IX 3, 3
(ID 1014)
Fläche: 25 qm
Räume
37, 39
Name(n)
Bottega del pittore
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden; bottega del pittore.;
Gebäude IX 3, 4
(ID 1015)
Fläche: 28 qm
Räume
36, 38
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Kunstgewerbe).;
Gebäude IX 3, 5.24
(ID 1016)
Fläche: 605 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, f
Name(n)
Casa delle Suonatrici; Casa di M. Lucretius Stabia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des vinarius M. Lucretius Stabia, flamen Martis und Decurio, und der Lucretii Sabinus und Secundus; Wohnung des medicus Phosphorus (?) mit Praxis in 6 (?); Casa delle Suonatrici.;
Gebäude IX 3, 6
(ID 1018)
Fläche: 27 qm
Räume
35, 40
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Phosphorus, medicus? Arztpraxis oder farmacia (gehört zu Haus 5).;
Gebäude IX 3, 7
(ID 1019)
Fläche: 38 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kunstgewerbe-Laden des Philocalus (Steinschneider?).;
Gebäude IX 3, 8
(ID 1020)
Fläche: 25 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega o officina di Titus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Titus (?) (in 8 und 9?).;
Gebäude IX 3, 9
(ID 1021)
Fläche: 24 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega o officina di Titus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt des Titus (8 und 9?), Tischlerei?;
Gebäude IX 3, 13
(ID 1023)
Fläche: 100 qm
Räume
a, b, d, e, e', f
Name(n)
Caupona e casa di Fabius Celer
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona und Wohnung des Fabius Celer.;
Gebäude IX 3, 14
(ID 1024)
Fläche: 65 qm
Räume
a, b, c, d, d'
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Haushaltswaren und Geschirr). Reparaturwerkstatt und Wohnung des C. Catius Scithus.;
Gebäude IX 3, 15
(ID 1025)
Fläche: 335 qm
Räume
a, a', b, c, d, e, f, g, h, i, k, k', k'', l, m, n, o, p, q
Name(n)
Casa di Philocalus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Philocalus.;
Gebäude IX 3, 16
(ID 1026)
Fläche: 35 qm
Räume
a, b
Name(n)
Officina coactiliaria di C. Tettius Faustus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: officina coactiliaria des C. Tettius Faustus.;
Gebäude IX 3, 17
(ID 1027)
Fläche: 57 qm
Räume
1, a, b, c, c', d
Name(n)
Casa di Q. Sallustius Inventus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus des Q. Sallustius Inventus, mit Verkauf von Metallwaren? asinarius, iumentarius.;
Gebäude IX 3, 18
(ID 1028)
Fläche: 60 qm
Räume
a, b, c, d
Name(n)
Kleines Geschäftshaus eines faber ferrarius
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus des faber ferrarius P. Paccius Clarus mit Geschäft der Statia (Verkauf von Haushaltswaren, Werkzeugen)?;
Gebäude IX 3, 19.20
(ID 1029)
Fläche: 341 qm
Räume
a, a-19, b, b-19, c, c-19, d, d-19, e, e-19, f, g, h, i, k, l, l'
Name(n)
Pistrinum dulciarium di Pyramus e Statia
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Pistrinum, pistrinum dulciarium des Pyramus und der Statia, Besitz und Wohnung des Getreidehändlers Papirius Sabinus, mit Laden des T. Genialis.;
Gebäude IX 3, 23
(ID 1031)
Fläche: 145 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Atriumhaus (Notquartier n. Erdb.).;
Gebäude IX 3, 25
(ID 1033)
Fläche: 98 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5
Name(n)
Casa di L. Clodius Varus e Pelagia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. Clodius Varus und der Pelagia.;
Gebäude IX 4, 2
(ID 1035)
Fläche: 33 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden, keine Einbauten erkennbar. R. Treppe zum HG?;
Gebäude IX 4, 3
(ID 1036)
Fläche: 33 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden wie oben 2.;
Gebäude IX 4, 4
(ID 1037)
Fläche: 34 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden wie oben 2.;
Gebäude IX 4, 6
(ID 1039)
Fläche: 30 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IX 4, 7
(ID 1040)
Fläche: 30 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IX 4, 8
(ID 1041)
Fläche: 31 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Juweliergeschäft?).;
Gebäude IX 4, 9
(ID 1042)
Fläche: 33 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IX 4, 11
(ID 1043)
Fläche: 22 qm
Räume
a
Name(n)
Latrina
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Öffentliche Latrine unter Treppe zum OG in 11.;
Gebäude IX 4, 12
(ID 1044)
Fläche: 4 qm
Räume
a
Name(n)
Scala separata
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG.;
Gebäude IX 4, 17
(ID 1048)
Fläche: 35 qm
Räume
a
Name(n)
Popina?
Kategorien
Gastwirtschaft
Funde
Wandgemälde: Bankettszene und Spiel nach dem Essen
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Popina? Erfrischungsraum?;
Gebäude IX 4, 19
(ID 1050)
Fläche: 39 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IX 5, 1.2.3.22
(ID 1052)
Fläche: 461 qm
Räume
1-1, 1-3, a, b, c, d, e, f, g', h', i, k, m, n', o', p, p', p'', p''', p'''', q', r', s, t, u, w, x, y, y', z
Name(n)
Casa di Achille; Haus des Stronnius; Haus mit den Skeletten
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Stronnius; Haus mit den Skeletten; Casa di Achille.;
Gebäude IX 5, 4
(ID 1053)
Fläche: 196 qm
Räume
a, b, c, d, e, e', e'', f, f1, g, h
Name(n)
Pistrinum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Pistrinum.;
Gebäude IX 5, 5
(ID 1054)
Fläche: 12 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleiner Laden (Mehlverkauf?).;
Gebäude IX 5, 7
(ID 1056)
Fläche: 14 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude IX 5, 8
(ID 1057)
Fläche: 35 qm
Räume
a, b, c, d
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus mit Laden (Lebensmittelverkauf?) des Nicandros Dorifestus?;
Gebäude IX 5, 9
(ID 1058)
Fläche: 328 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, i', i'', i''', l, m, n, o, p, q
Name(n)
Casa dei Pigmei; Haus mit den vergoldeten Figuren
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Poppaeus Sabinus? Casa dei Pigmei; Haus mit den vergoldeten Figuren.;
Gebäude IX 5, 10
(ID 1059)
Fläche: 37 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelgeschäft?).;
Gebäude IX 5, 11.13
(ID 1060)
Fläche: 334 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, n', n'', o, p, q, r, s, t, v
Name(n)
Casa di Poppaeus Primus (?); Haus des Poppaeus Primus (?); Haus mit den Musenbildern
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Poppaeus Primus? Haus mit den Musenbildem.;
Gebäude IX 5, 12
(ID 1061)
Fläche: 23 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IX 5, 14.15.16
(ID 1063)
Fläche: 692 qm
Räume
a, a', b, b', c, c', d, d', e, e', f, f', g, h, i, k, k', k'', l, m, n, o, p, p', q, r, s, s', t
Name(n)
Casa del ristorante
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Ristorante mit Lupanar.;
Gebäude IX 5, 18.19.20.21
(ID 1065)
Fläche: 357 qm
Räume
a, b, b', b'', b''', b'''', c, c', c'', d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, w, w'
Name(n)
Casa di Jasone; Das vom Blitz getroffene Haus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa di Jasone; Das vom Blitz getroffene Haus.;
Gebäude IX 6, 2
(ID 1068)
Fläche: 3 qm
Räume
b
Name(n)
Cella meretricia (?)
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG mit cella meretricia?;
Gebäude IX 6, 3
(ID 1069)
Fläche: 214 qm
Räume
1, 2, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m
Name(n)
Casa di P. F. L.; Casa di Q. Bruttius Balbus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des P. F. L.;
Gebäude IX 6, 4.5.6.7
(ID 1070)
Fläche: 873 qm
Räume
1, 1-4, 1-6, 2, 2-4, 3, a, a1, b, c, d, d1, e, e1, f, g, h, i, k, l, m, o, o1, o2, o3, p, q, r, s, t, u, w, x, y, z
Name(n)
Casa di Jucundus e Quartilla; Casa di Oppius Gratus; Haus des Jucundus und der Quartilla; Haus des Oppius Gratus architectus und seiner Frau Quartilla, mit Wohnung des Pyramus; House of Oppius Gratus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Jucundus und der Quartilla; Haus des Oppius Gratus architectus und seiner Frau Quartilla, mit Wohnung des Pyramus.;
Gebäude IX 6, 8
(ID 1071)
Fläche: 107 qm
Räume
1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa del Larario; Lupanar des Amandus; Lupanar di Amandus
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Gastronomie; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lupanar des Amandus; Casa del Larario (di Venere?).;
Gebäude IX 6, b
(ID 1073)
Fläche: 39 qm
Räume
1, 2, 3
Name(n)
Caupona di Marcus
Kategorien
caupona; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona des Marcus (Exgladiator?) und Une...us.;
Gebäude IX 6, c
(ID 1074)
Fläche: 41 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Bottega; Fondo dell'Aquila
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Fondo dell'Aquila. Laden (Lebensmittelverkauf).;
Gebäude IX 6, e.d
(ID 1075)
Fläche: 96 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h
Name(n)
Casa di Dido ed Aeneas; Caupona e bottega di C. Cornelius Clu...?
Kategorien
caupona; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Aeneas und Dido; Wandgemälde: Polyphem
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona mit Laden eines lib. oder servus des C. Cornelius Clu...?; Casa di Dido ed Aeneas.;
Gebäude IX 6, f
(ID 1076)
Fläche: 23 qm
Räume
1, 2, 3
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großer Laden (Seilerwaren?).;
Gebäude IX 6, g
(ID 1077)
Fläche: 603 qm
Räume
1, 2, 3, 4b, a, b, c, d, g, g1, h, k, l, m, p
Name(n)
Haus des C. Cornelius Clu...
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des C. Cornelius Clu...;
Gebäude IX 7, 1
(ID 1079)
Fläche: 24 qm
Räume
-
Name(n)
Filzmacherei; Officina coactiliaria; Taberna delle quattro divinità
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: officina coactiliaria; Taberna delle quattro divinità. Ladeneingang.; SLuecke: Officina coactilaria = Filzmacherei; s. ;
Gebäude IX 7, 2
(ID 1080)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Officina infectorum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: officina infectorum (Färber für neue Wolle). Inquilini des P. Sittius Coniunctus?;
Gebäude IX 7, 3
(ID 1081)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Sittii Pompeiani; Casa di P. Sittius Coniunctus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Sittii Pompeiani; Haus des P. Sittius Coniunctus.;
Gebäude IX 7, 4
(ID 1082)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega; Laden des Sergius Felix
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Sergius Felix.;
Gebäude IX 7, 5.6.7
(ID 1083)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Quadriga di Venere
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und Werkstätten des vestiarius M. Vecilius Verecundus; officina coactiliaria, textoria, Fabrik der Tunica lintea aurata; Verkauf von Filz und Leinen; Casa della Quadriga di Venere. Laden der Cuculla?;
Gebäude IX 7, 8
(ID 1084)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con sovrastante Meniano
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa con sovrastante Meniano.; S. Lücke: Der italienische Name des Hauses bezieht sich auf die erhaltenen Reste des Obergeschosses (s. https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R9/9%2007%2008.htm). Zu "Meniano" s. https://www.treccani.it/vocabolario/meniano/ ("Nell’architettura romana, sporgenza (oltre la verticale dei muri o di un portico) a una certa altezza dell’edificio, a guisa di loggia o balcone");
Gebäude IX 7, 9
(ID 1085)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Popidius Montanus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Popidius Montanus; Im OG Saal der Latrunculari.;
Gebäude IX 7, 10
(ID 1086)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IX 7, 11
(ID 1087)
Fläche: 41 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega e officina di Jucundus (?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden und Werkstatt des Jucundus? Bronzewaren? (angegraben, später abgemauert).;
Gebäude IX 7, 12
(ID 1088)
Fläche: 30 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Polyphem e Galathea
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Polyphem und der Galathea.;
Gebäude IX 7, 13
(ID 1089)
Fläche: 49 qm
Räume
1
Name(n)
Thermopolium
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium.;
Gebäude IX 7, 14
(ID 1090)
Fläche: 25 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Casa (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: posticum?;
Gebäude IX 7, 15
(ID 1091)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Cella meretricia sotto scala
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG, darunter cella meretricia (zu 14?).;
Gebäude IX 7, 16
(ID 1092)
Fläche: 297 qm
Räume
1, 2, 3, 6, 7, a, b, c, d, d1, e
Name(n)
Casa del Cavallo Troiano; Haus des A. Virnius Modestus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des A. Virnius Modestus; Casa del Cavallo Troiano.;
Gebäude IX 7, 17
(ID 1093)
Fläche: 6 qm
Räume
1
Name(n)
Treppe
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG mit Latrine.;
Gebäude IX 7, 20
(ID 1095)
Fläche: 539 qm
Räume
1, a, b, c, d, e, f, g, g1, g2, g3, g4, h, i, j, k, l, m, n, o, o1, p, p1, q, r, s, t, t1, u, v, w
Name(n)
Casa della Fortuna; Casa delle archi; Casa di D. Caprasius Felix e Fortunata
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des lanipendius D. Caprasius Felix und der Fortunata mit textoria? Haus mit Bogenperistyl: Casa delle archi; Casa della Fortuna.;
Gebäude IX 7, 23
(ID 1097)
Fläche: 42 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Caupona di Ti. Claudius Epaphroditus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona und Schenke des vinarius Ti. Claudius Epaphroditus.;
Gebäude IX 7, 24.25
(ID 1098)
Fläche: 264 qm
Räume
1, 2, a, b, e, f, g, i, l, m, n, o, p, q, s, t, u
Name(n)
Thermopolium, Popina, Hospitium di MM. Fabii Memor e Celer
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium, popina, hospitium der MM. Fabii Memor und Celer.;
Gebäude IX 7, 26
(ID 1099)
Fläche: 44 qm
Räume
c
Name(n)
Caupona o lupanare di Fabius Memor
Kategorien
Bordell; caupona; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Caupona-Lupanar des Fabius Memor.;
Gebäude IX 8, 1
(ID 1100)
Fläche: 50 qm
Räume
1, 2, 3
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Seitenräumen und Wohnung (zu 2?). Fischgeschäft?;
Gebäude IX 8, 2
(ID 1101)
Fläche: 21 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Hortulus di Potitus, ludimagister
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: hortulus des Potitus, ludimagister; Scuola philosophica epicurea des Magister Potitus Poppaei Sabini proc.;
Gebäude IX 8, 4
(ID 1103)
Fläche: 32 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des negotiator aerarius und ferrarius Ambriaeus und der Vibia. ;
Gebäude IX 8, 5
(ID 1104)
Fläche: 9 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Werkzeugen) (zu 4?).;
Gebäude IX 8, a.3.6
(ID 1105)
Fläche: 2025 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 41, 41a, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 9c, a, b, c, d, d', e', i, j, k, l, m, n, n', o', p', q', r', s', t'
Name(n)
Casa del Centenario; Casa del Fauno ubbriaco; Haus des vinarius A. Rustius Verus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des vinarius A. Rustius Verus mit Wohnung des C. Seppius Fructus; Casa del Fauno ubbriaco; Casa del Centenario.;
Gebäude IX 8, 7
(ID 1106)
Fläche: 10 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleiner Laden mit Treppe zum OG mit Wohnung des sacomarius Urbanus.;
Gebäude IX 8, b
(ID 1109)
Fläche: 138 qm
Räume
1, 2, a, a1, b, c, d, e, f, h
Name(n)
Hospitium di C. Hyginus Firmus
Kategorien
Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: hospitium des C. Hyginius Firmus.;
Gebäude IX 8,
(ID 1110)
Fläche: 2147483647 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (parzialmente scavata)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Teil eines Hauses (nur angegraben).;
Gebäude IX 9, a.1.2
(ID 1111)
Fläche: 287 qm
Räume
1, 2, 3, a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p
Name(n)
Casa (con thermopolium e caupona) di L. Statius Receptus
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit thermopolium und caupona des L. Statius Receptus.;
Gebäude IX 9, 6.7.10
(ID 1113)
Fläche: 598 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p
Name(n)
Casa di Vinaio; Geschäftshaus des vinarius C. Caesius Restitutus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus des vinarius C. Caesius Restitutus; Casa di Vinaio; Domus religiosa.;
Gebäude IX 9, c.b
(ID 1117)
Fläche: 187 qm
Räume
a, a', b, d, d', d'', e, f, g, k, l, p
Name(n)
Casa del Maiale; Casa del Porco; Casa di C. Sulpicius Rufus
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Sulpicius Rufus, Q. Nolanius Primus und der Caesia Helpix; Casa del Porco; Casa del Maiale.;
Gebäude IX 9, d
(ID 1118)
Fläche: 171 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, k, l, m, n
Name(n)
Casa
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus.;
Gebäude IX 9, f
(ID 1120)
Fläche: 53 qm
Räume
a, b, c, e, f
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: The Doctor's House? Einfaches Haus eines Feldarbeiters?;
Gebäude IX 9, g
(ID 1121)
Fläche: 61 qm
Räume
a, b, d, e, f
Name(n)
Officina libraria o scriptoria
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des pictor und programmatum scriptor P. Aemilius Celer. Officina libraria o scriptoria.;
Gebäude IX 10, 1
(ID 1122)
Fläche: 402 qm
Räume
-
Name(n)
Panificio di Aulus Rustius Verus
Kategorien
-
Funde
Wandgemälde: Paris begegnet Helena
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hauseingang. Modern abgemauert.;
Gebäude IX 10, 2
(ID 1123)
Fläche: 276 qm
Räume
1, 10, 11, 119s1, 11a, 11s1, 12, 13, 13s1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 2a, 2s1, 3, 30, 31, 315, 32, 33, 34, 35, 4, 42, 42a, 42b, 42c, 42d, 43, 44, 45, 5, 6, 6s1, 7, 8, 9, A, B, B1, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, H, I, K, L, OS1
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; fullonica; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus.;
Gebäude IX 11, 1
(ID 1124)
Fläche: 38 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (di Cn. Audius Bassus?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Cn. Audius Bassus? Nicht ausgegraben.;
Gebäude IX 11, 5
(ID 1128)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt.;
Gebäude IX 11, 6
(ID 1129)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Officina (fullonica?)
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt (Fullonica?).;
Gebäude IX 11, 7
(ID 1130)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Casa (di Cornelius Maximus?)
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Cornelius Maximus?;
Gebäude IX 11, 8
(ID 1131)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Verschlossener Eckladen, caupona? (Bretterverschluß).;
Gebäude IX 12, 3.4.5
(ID 1133)
Fläche: 293 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m', n, o, p
Name(n)
Casa del secondo Cenacolo colonnato
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del secondo Cenacolo colonnato mit textrina des M. Comus und Läden.;
Gebäude IX 12, 6.7.8
(ID 1134)
Fläche: 400 qm
Räume
1, 2, a, b, c, c'', d, e, f, g, h, i, l, m, n, n', o
Name(n)
Casa dei casti amanti
Kategorien
Atriumhaus; Gastronomie
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: In Ausgrabung begriffen.;
Gebäude IX 13, 4.5.6
(ID 1135)
Fläche: 69 qm
Räume
1, 2, 3, 4, DD
Name(n)
Casa delle Origini di Roma; Haus des fullo M. Fabius Ululitremulus
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des fullo M. Fabius Ululitremulus; Casa delle Origini di Roma. Laden des Successus und officina des Sextus Ceius.;
Gebäude IX 14, c.2.4
(ID 1137)
Fläche: 1762 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 29, 2a, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42a, 42b, 42c, 42d, 43, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, B1, B2, B3, B4, C, D, E, F, G, H, I, K, L
Name(n)
Casa dei MM. Obellii Firmi; Casa del Conte di Torino
Kategorien
Atriumhaus; Gastronomie; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der MM. Obellii Firmi, pater et filius; Casa del Conte di Torino.;
Gebäude IX 14, 3
(ID 1138)
Fläche: 17 qm
Räume
36a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; fullonica; Gastronomie; Handel und Gewerbe; Laden; Stall; Wasserversorgung
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden eines negotiator ferrarius? Bottega di un Veterarius.;
Gebäude I 2, 19.18.17
(ID 1175)
Fläche: 376 qm
Räume
a, a-18 vendita, a-19, b, b-18, c, c-19, d, d-19, e, f, g, h, i, k, l, m, o, p, q, s, t
Name(n)
Lupanar, caupona e thermopolium di Demetrius
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lupanar, caupona und thermopolium des Demetrius und der Helpis Afra mit Schmuckhandel und -reparaturen?;
Gebäude II 9, 2
(ID 1189)
Fläche: 191 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del gemmario
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Gemmario, Haus des Juweliers mit Werkstatt.;
Gebäude II 9, 5.6
(ID 1190)
Fläche: 189 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dell'Triclinio all'aperto
Kategorien
Garten; Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa dell' Triclinio all' aperto, hospitium (?) , mit Fremdenzimmern für etwa 12 Personen (Garten verbunden mit 3 und 4).;
Gebäude III 1, 3
(ID 1191)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dell'Ancora rossa; Haus des Pacuvius
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Pacuvius (Hersteller oder Verkäufer von Schiffbedarf?); Casa dell' Ancora rossa.;
Gebäude III 3, 6
(ID 1192)
Fläche: 146 qm
Räume
-
Name(n)
Armamentario; Schola armaturarum Iuventutis Pompeianae; Schola Iuventutis Pompeianae
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Armamentario, Schola Iuventutis Pompeianae, Schola armaturarum Iuventutis Pompeianae.;
Gebäude III 5, 3
(ID 1193)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Ladeneingang. Vereinslokal des sodalicium Paridianum? (Fans des Schauspielers Paris).;
Gebäude III 7, 5
(ID 1194)
Fläche: 38 qm
Räume
-
Name(n)
N/A
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Eingang an hohem Bürgersteig;
Gebäude IV 1, 6
(ID 1195)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Breiter Hauseingang, r. Treppe zum OG (?). Balkon?;
Gebäude IV 1, 7
(ID 1196)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (zu 5?);
Gebäude IV 3, 1
(ID 1197)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude IV 5, 1
(ID 1198)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Wohnung.;
Gebäude V 1, 24
(ID 1200)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega; Laden des Faustus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Faustus;
Gebäude VI 2, 11
(ID 1203)
Fläche: 131 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Haus;
Gebäude VII 1, 32
(ID 1212)
Fläche: 53 qm
Räume
1, 2, 3, 4
Name(n)
Popina, caupona di Clodius Nymphodotus?
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Popina, caupona des Clodius Nymphodotus?;
Gebäude VII 1, 33.34.35
(ID 1213)
Fläche: 49 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5
Name(n)
Casa di Clodius Nymphodotus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus des Clodius Nymphodotus mit Eckladen, taberna argentaria des Caesius Anulinus (?) und Werkstatt (Metall-, Holz- oder Steinwaren?).;
Gebäude VII 1, 59
(ID 1215)
Fläche: 11 qm
Räume
1
Name(n)
Scala separata per accedere al piano superiore dei negozi
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separater Treppenaufgang zum HG der Läden.;
Gebäude I 1, 2
(ID 1219)
Fläche: 75 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Popina (di Epagatus?)
Kategorien
Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Popina (des Epagatus?);
Gebäude I 1, 6.7.8.9
(ID 1221)
Fläche: 283 qm
Räume
a, a-9, b, b-9, c, d, e, f, g, h, i
Name(n)
Hospitium di Hermes; hospitium Hermetis; Stabulum des Hermes
Kategorien
Herberge; Hospitium; Stall
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: stabulum des Hermes, hospitium Hermetis, statio mulionum;
Gebäude I 2, 2.3.4
(ID 1223)
Fläche: 233 qm
Räume
1, a, a-4, b, b-4, c, d, e, f, g, h, m, n, o
Name(n)
Casa con colonna etrusca; Casa della cosidetta Collana (sic) Etrusca
Kategorien
Atriumhaus; Garten; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa con colonna etrusca, Casa della cosidetta Collana (sic) Etrusca. Atriumhaus mit geschlossenem tablinum und kleinem Garten.;
Gebäude I 2, 5
(ID 1224)
Fläche: 26 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Haushaltswaren) mit 2 einfachen Hinterzimmern und Latrine.;
Gebäude I 2, 6
(ID 1225)
Fläche: 285 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o
Name(n)
Casa degli Attori; Casa dei Mimi
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Unregelmäßiges Atriumhaus (mit dem Raub des Palladiums). Casa degli Attori, Casa dei Mimi.;
Gebäude I 2, 7.8
(ID 1226)
Fläche: 61 qm
Räume
a, a-7, b, b-7
Name(n)
Caupona degli Sposi; Caupona degli sposi C. Hostilius e Hirtia Psacas
Kategorien
caupona; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium und Laden eines Ehepaares, des C. Hostilius Conops und der Hirtia Psacas. caupona degli Sposi.;
Gebäude I 2, 9.10
(ID 1227)
Fläche: 221 qm
Räume
1, 2, a, b, c, d, e, f, g, h, i
Name(n)
Casa di L. Volusius Faustus ed M. Volusius Faustus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Atriumhaus der L. und M. Volusius Faustus; L. Volusius Faustus garum (liquamen)- Produzent, M. Volusius Faustus (Importeur oder Zwischenhändler von Silber- und Bronzegegenständen?);
Gebäude I 2, 11
(ID 1228)
Fläche: 21 qm
Räume
a-11, b-11
Name(n)
Bottega
Kategorien
Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden und Thermopolium (?) mit kleinem Hinterzimmer (Metall-, Stein- oder Holzwaren).;
Gebäude I 2, 15
(ID 1230)
Fläche: 112 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Eingang ohne fauces zum querliegenden einhüftigen atrium tusc. mit gemauertem impluvium (Marmor?), r. Zisterne. Nebenräume.;
Gebäude I 2, 16
(ID 1231)
Fläche: 208 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g
Name(n)
Casa di un medico (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus eines griech. oder alex. Arztes oder Masseurs? Hofhaus mit zweiseitigem Pseudoperistyl und Nebenräumen.;
Gebäude I 2, 20.21
(ID 1233)
Fläche: 133 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k
Name(n)
Caupona e Lupanare di Innulus e Papilio
Kategorien
Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona, thermopolium und lupanar des Pollius oder Minius;
Gebäude I 2, 22
(ID 1234)
Fläche: 138 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Öl- und Weinhandlung?);
Gebäude I 2, 23
(ID 1235)
Fläche: 32 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Verecundus (Lebensmittel?);
Gebäude I 2, 24.25.26
(ID 1236)
Fläche: 361 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, h, k, l, m, n, N/A 25, o, p, q
Name(n)
Officina libraria di Acilius Cedrus, L. Aelius Cydinus, Appuleius Adiutor, P. Instuleius, C. Nonius Lorica
Kategorien
Gastronomie; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit Laden, officina libraria der Schreiber, Kopisten und Buchhändler Acilius Cedrus, L. Aelius Cydinus, Appuleius Adiutor, P. Instuleius Nedymus, C.Nonius Lorica, (Hinnulus und Papilio?).;
Gebäude I 2, 27.28.29
(ID 1237)
Fläche: 327 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o
Name(n)
Casa del Atrio tetrastilo; Casa della Grata metallica; Haus der Kassandra; Haus und thermopolium des Polybios
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; thermopolium; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und thermopolium des Polybios; Haus der Kassandra; Casa della Grata metallica, Casa del Atrio tetrastilo.;
Gebäude I 3, 1
(ID 1239)
Fläche: 74 qm
Räume
a, b, c, d
Name(n)
Pistrinum dulciarium
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Pistrinum dulciarium;
Gebäude I 3, 2
(ID 1240)
Fläche: 17 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittel);
Gebäude I 3, 3.4.31
(ID 1241)
Fläche: 607 qm
Räume
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, g, h, k, l, m, m', n, p, q, q', r, u, v, x, y, z
Name(n)
Casa e officina di Epidius Fortunatus
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und Werkstatt des Epidius Fortunatus (Holz-, Metall- oder Steinarbeiten?); Wohnung des Q. Spurennius Priscus?;
Gebäude I 3, 7
(ID 1243)
Fläche: 19 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Verkauf von Linsen).;
Gebäude I 3, 11
(ID 1246)
Fläche: 41 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Lebensmittelverkauf?);
Gebäude I 3, 12
(ID 1247)
Fläche: 26 qm
Räume
1, a, b
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Holz-, Stein- oder Metallwaren);
Gebäude I 3, 15
(ID 1249)
Fläche: 60 qm
Räume
1, a, b
Name(n)
Officina (conceria?) di Sestius Venustus
Kategorien
Gerberei; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Vermietete Werkstatt (Gerberei?) des Sestius Venustus;
Gebäude I 3, 23
(ID 1252)
Fläche: 323 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, o', o'', p, q, r
Name(n)
Casa di Actius Anicetus; Domus della Rissa nell'anfiteatro Pompeiano
Kategorien
Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Darstellung der Fankrawalle am Amphitheater im Jahr 59 n. Chr.
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Actius Anicetus, domus della Rissa nell' anfiteatro Pompeiano, Haus eines Exgladiators;
Gebäude I 3, 24
(ID 1253)
Fläche: 258 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, p, q, r
Name(n)
Casa di Capella
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Capella (Kaufmann).;
Gebäude I 3, 27
(ID 1255)
Fläche: 179 qm
Räume
1, a, b, c, d, e, f, g, h
Name(n)
Pistrinum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Pistrinum;
Gebäude I 3, 28
(ID 1256)
Fläche: 27 qm
Räume
1
Name(n)
Thermopolium
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Einräumiges thermopolium;
Gebäude I 3, 29
(ID 1257)
Fläche: 99 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i
Name(n)
Casa di Innulus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Innulus, scriptor;
Gebäude I 3, 30
(ID 1258)
Fläche: 155 qm
Räume
a, b, c, d, e, e'', f, f', f'', g, h, i, k, l, m
Name(n)
Casa
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Peristylhaus, Hofhaus mit Werkstatt?;
Gebäude I 4, 4
(ID 1261)
Fläche: 30 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega (?)
Kategorien
Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Vielleicht gemeinsamer Pächter von thermopolium und Laden?;
Gebäude I 4, 5.6.25.28
(ID 1262)
Fläche: 2247 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 64a, 64b, 66, 67, 68, 69, 7, 72, 72a, 73, 73a, 73b, 73c, 8, 9
Name(n)
Casa del Citarista; Domus des L. Popidius Secundus (Augustianus)
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus des L. Popidius Secundus (Augustianus) mit Wohnung des L. Rapinasius Optatus; Casa del Citarista.;
Gebäude I 4, 7
(ID 1263)
Fläche: 49 qm
Räume
-
Name(n)
Fullonica di Passaratus e Maenianus
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleine fullonica des Passaratus und Maenianus.;
Gebäude I 4, 8
(ID 1264)
Fläche: 18 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Einräumiger Laden, an Rückwand gemauerte Treppe zum OG.;
Gebäude I 4, 11
(ID 1266)
Fläche: 73 qm
Räume
a, b, c, d, e
Name(n)
Caupona di Copiosus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona des (Syrers) Copiosus.;
Gebäude I 4, 12.13.14.15.16.17
(ID 1267)
Fläche: 341 qm
Räume
a, a-13, a-14, a-16, a-17, b, b-13, c, d, e, f, h, i
Name(n)
Panificio, pistrinum, bottega
Kategorien
Bäckerei; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Großbetrieb mit Bäckereien und Läden des D. Junius Proculus (Magonius?), nicht verbunden mit den Häusern 5,25, aber vermutlich von deren Besitzern (Getreide- und Weinproduzenten) gepachtet.;
Gebäude I 4, 18
(ID 1268)
Fläche: 35 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina di Sabinus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt des Sabinus, negotiator? dissignator.;
Gebäude I 4, 19
(ID 1269)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit Retrobottega.;
Gebäude I 4, 22
(ID 1271)
Fläche: 231 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Pressorio di Terracotta
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Pressorio di Terracotta;
Gebäude I 4, 23.24
(ID 1272)
Fläche: 57 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Doppelladen, beide Ladenräume sind durch einen breiten Durchgang miteinander verbunden. Verkauf von Metallwaren und -werkzeugen. Kleine Schmiede für Reparaturen?;
Gebäude I 4, 26
(ID 1274)
Fläche: 45 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Officina lanifricaria di Dionysius
Kategorien
fullonica
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Officina lanifricaria des Dionysius.;
Gebäude I 4, 27
(ID 1275)
Fläche: 35 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Thermopolium
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium;
Gebäude I 5, 1
(ID 1276)
Fläche: 42 qm
Räume
a, b, c, d, e
Name(n)
Bottega; Casa dei capitelli etruschi; Casetta degli capitelli cosi detti etruschi
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Töpferladen (Casetta degli capitelli cosi detti etrusci, Casa dei capitelli etruschi);
Gebäude I 5, 2
(ID 1277)
Fläche: 657 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s
Name(n)
Conceria di M. Vesonius Primus
Kategorien
Gerberei
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Gerberei des M. Vesonius Primus;
Gebäude I 5, 3
(ID 1278)
Fläche: 784 qm
Räume
m, t
Name(n)
Rovine a sud della conceria
Kategorien
Gerberei
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Trümmergrundstück südlich der Gerberei;
Gebäude I 6, 1
(ID 1279)
Fläche: 32 qm
Räume
1, 2, 3
Name(n)
Laden und Werkstatt eines faber ferrarius
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden und Werkstatt des Tyrsus, faber ferrarius, Geräte- und Werkzeugherstellung;
Gebäude I 6, 2.16
(ID 1280)
Fläche: 1127 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22l, 23, 23l, 24, 25, 25l, 26, 26l, 27, 27l, 28, 28l, 29, 3, 30, 31, 31l, 32, 32l, 33, 33l, 34, 34l, 35, 35l, 36, 36l, 37, 37l, 38, 38l, 39, 39l, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9
Name(n)
Casa del criptoportico
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: rep. zusammengelegter samn. Häuserkomplex, n. Erdb. in Aufteilung begriffen?;
Gebäude I 6, 3
(ID 1281)
Fläche: 30 qm
Räume
a, b
Name(n)
Officina di Vero gromatico
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt und Reparaturwerkstatt des faber aerarius, ferrarius? Verus. Officina di Vero gromatico.;
Gebäude I 6, 4
(ID 1282)
Fläche: 405 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m', n, o, p, q, r, s, s', t
Name(n)
Casa del Larario di Achille; Casa del Sacello Iliaco; Casa del Salone degli Elefanti
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Larario di Achille, del Sacello Iliaco, del Salone degli Elefanti.;
Gebäude I 6, 7
(ID 1284)
Fläche: 315 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, p, p', p'', p''', q, q', r
Name(n)
Fullonica di Stephanus
Kategorien
Atriumhaus; fullonica; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Fullonica des Stephanus;
Gebäude I 6, 8.9.11
(ID 1285)
Fläche: 730 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, a-9, b-9, c, d, d', e, e', f, g, h, i, l
Name(n)
Casa dei Quadretti Teatrali; Domus der Calavii; Domus di P. Casca Longus; Haus des Kanachos-Apoll
Kategorien
Atriumhaus; fullonica; Handel und Gewerbe; Laden; Lebensmittel; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus der Calavii, St. und Crescens und der Calavia Optata (Domus di P. Casca Longus, Casa dei Quadretti Teatrali, Haus des Kanachos-Apoll. Doppelhaus einer reichen Kaufmannsfamilie. 8 Laden der Specula? (Lebensmittelverkauf?) 9 Wohnung der Calavia Optata.;
Gebäude I 6, 12
(ID 1286)
Fläche: 45 qm
Räume
m', n'
Name(n)
Casa del Falconiere; Laden des Iunianus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Iunianus, veteranus, negotiator aerarius oder ferrarius. Casa del Falconiere.;
Gebäude I 6, 15
(ID 1289)
Fläche: 287 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, g1, h, i, k, l, m
Name(n)
Casa dei Cei
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus der Cei, des L. Ceius Secundus und der Fabia Prima (Mitbewohner deren Bruder Fabius Tyrannus und der Diener Thyrsus). Casa della Caccia, dei Paesaggi, dei grande paesaggi egizi, Casa della Regina Elena.; Strocka 1990: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa dei Cei : I 6,15 [1990];
Gebäude I 7, 1.20
(ID 1290)
Fläche: 749 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 9b, 9c, 9d
Name(n)
Casa di P. Paquius Proculus; Haus des C. Cuspius Pansa
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des P. Paquius Proculus; Haus des C. Cuspius Pansa.; Strocka 1998: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa di Paquius Proculus : (I 7,1.20) [1998];
Gebäude I 7, 4
(ID 1292)
Fläche: 47 qm
Räume
1, 2
Name(n)
Officina vasaria di Corinthus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: officina vasaria des Corinthus, servus des P. Cornelius?;
Gebäude I 7, 5
(ID 1293)
Fläche: 66 qm
Räume
a, b, c, d
Name(n)
Casa di Philippus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Philippus (?), mit Werkstatt eines faber lignarius (?).;
Gebäude I 7, 6
(ID 1294)
Fläche: 20 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega di Primilla
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden der Primilla mit Wohnung.;
Gebäude I 7, 7
(ID 1295)
Fläche: 217 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r
Name(n)
Casa del sacerdos Amandus; Casa dell'Affresco di Spartaco
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Priesters Amandus, Casa dell' Affresco di Spartaco mit Werkstatt eines faber lignarius tabellarius (im OG?).;
Gebäude I 7, 10.11.12.19
(ID 1297)
Fläche: 935 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, a', a'', b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u
Name(n)
Casa dell'Efebo; Domus des P. Cornelius Tages
Kategorien
Wasserversorgung
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Domus des P. Cornelius Tages, Casa dell' Efebo;
Gebäude I 7, 13.14
(ID 1298)
Fläche: 87 qm
Räume
1, 1-13, 2, 2-13, 3, 3-13, 4-13, 5-13
Name(n)
Caupona e lupanare di Masculus
Kategorien
Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona und Lupanare des Masculus (princeps caudatorum Pompeianorum).;
Gebäude I 7, 18
(ID 1300)
Fläche: 130 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, h
Name(n)
Bottega di Niraemius
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäft und Wohnung des Niraemius, Bronzehändler.;
Gebäude I 8, 1.2.3
(ID 1302)
Fläche: 387 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di Stephanus (?)
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe; Laden; thermopolium; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: haus des Stephanus? thermopolium, Weinstube, Laden des Felix Pomarius;
Gebäude I 3, 8a
(ID 1322)
Fläche: 80 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Unregelmäßiges Haus.;
Gebäude I 3, 8b
(ID 1323)
Fläche: 377 qm
Räume
a, b, c, c', c'', d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s
Name(n)
Casa di Vulcanus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Vulcanus, Peristylhaus und Schmiedewerkstatt?;
Gebäude I 6, 10
(ID 1347)
Fläche: 41 qm
Räume
m, n
Name(n)
Officina, bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Tischlerwerkstatt und Verkauf von Holzwaren?;
Gebäude I 8, 4.5.6
(ID 1357)
Fläche: 375 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa della Statuetta Indiana
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Chrysanthus (Schiffseigner oder Kaufmann). Casa della Statuetta Indiana.;
Gebäude I 8, 7
(ID 1358)
Fläche: 18 qm
Räume
1
Name(n)
Bottega; Laden des L. B(v)etutius Placidus
Kategorien
fullonica; Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des L. B(v)etutius Placidus; Laden mit saltus fullonici.;
Gebäude I 8, 8.9
(ID 1359)
Fläche: 268 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Thermopolium di L. Vetutius Placidus e Ascula
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium des L. Vetutius Placidus und der Ascula, im OG sodalicium pistorum, Haus mit dem Raub der Europa.;
Gebäude I 8, 10
(ID 1360)
Fläche: 186 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, a
Name(n)
Hospitium e caupona di 'Pulcinella'
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: hospitium und caupona der 'Pulcinella' mit taberna vasaria (gleicher Besitzer wie 7-9?).;
Gebäude I 8, 12
(ID 1362)
Fläche: 80 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Forgia e stabulum
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Stall; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Schmiedewerkstatt und stabulum.;
Gebäude I 8, 13
(ID 1363)
Fläche: 221 qm
Räume
1, 2, 3, 4
Name(n)
Officina e casa di A. Granius Romanus
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt und Wohnung des A. Granius Romanus; Shop-House. Mitbewohner (?): Wucherin Faustilla, Diadumenus, Diophantus.;
Gebäude I 8, 14
(ID 1364)
Fläche: 171 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di M. Epidius Primus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Epidius Primus (Kaufmann) und des Epidius Rusticus?;
Gebäude I 8, 15.16
(ID 1365)
Fläche: 148 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Caupona e officina pigmentaria di N. Fufidius Successus
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona und Haus des Weinproduzenten N. Fufidius Successus mit officina pigmentaria (?) (des Gallus, Pallas, Melissus, Tullius Adeptus) oder antike Restaurierung nach 62 n. Chr.?;
Gebäude I 8, 11.17
(ID 1366)
Fläche: 511 qm
Räume
1, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa dei quattro stili; Haus des L. V. P. und der Quartilla
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des L. V. P. und der Quartilla; Casa dei quattro stili.;
Gebäude I 8, 18
(ID 1367)
Fläche: 197 qm
Räume
1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa dell'atrio dorico; Casa di Balbus
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Balbus; Casa dell'atrio dorico.;
Gebäude I 8, 19
(ID 1368)
Fläche: 110 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Name(n)
Infectoria (tintoria) di Terentius
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Infectoria des Terentius unter der Terrasse des Hauses 2.;
Gebäude I 9, 1.2
(ID 1369)
Fläche: 381 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del bell'impluvio; Casa delle due triadi divine
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del bell'impluvio mit Laden eines faber aerarius-, Casa delle due triadi divine; Haus eines CultorDomus Imperatoriae mit Metallwaren-Geschäft (?) in 2.;
Gebäude I 9, 5.6.7
(ID 1371)
Fläche: 375 qm
Räume
-
Name(n)
Casa dei Cubicoli floreali; Casa del Frutetto; Haus der Euplia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der Euplia; Casa del Frutetto; Casa dei Cubicoli floreali.;
Gebäude I 9, 8
(ID 1372)
Fläche: 187 qm
Räume
-
Name(n)
Officina di Romulus (?)
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Fischverarbeitungsbetrieb (?) des Romulus (?).;
Gebäude I 9, 11.12
(ID 1374)
Fläche: 413 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona e lupanare di Mestrius Maximus
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona des Amarantus Pompeianus und Lupanar des Q. Mestrius Maximus.;
Gebäude I 9, 15
(ID 1376)
Fläche: 62 qm
Räume
-
Name(n)
Locali di servizio situati nel seminterrato 1?
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Im Kellergeschoß liegende Wirtschaftsräume zu 1?;
Gebäude I 10, 1
(ID 1377)
Fläche: 83 qm
Räume
1, 2, 3, 4, 5
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Handwerkerhaus.;
Gebäude I 10, 4.14.15.16.17
(ID 1379)
Fläche: 1627 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20a, 20b, 21, 21a, 21b, 22, 23, 24, 25, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51a, 52, 53, 54, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, 56, 56a, 56b, 57, 57a, 58, 59, 6, 60, 61, 61a, 7, 8, 9, b, d
Name(n)
Casa del Menandro; Haus des Q. Poppaeus Sabinus und der Vatinia Primigenia
Kategorien
Wohnhaus
Funde
Wandgemälde: Ajas der Lokrer zerrt Kassandra vom Kultbild der Athena weg
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Q. Poppaeus Sabinus und der Vatinia Primigenia-, Casa del Menandro. Procurator Q. Poppaeus Eros.;
Gebäude I 10, 5
(ID 1380)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Lupanar
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Enger Eingang mit Treppe zum OG. Lupanar.;
Gebäude I 10, 6
(ID 1381)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Officina (di un faber marmorarius?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Magazin und Werkstatt eines faber marmorarius? Julius (servus des Nachbarn 7?).;
Gebäude I 10, 7
(ID 1382)
Fläche: 262 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Fabbro; Haus des Q. Poppaeus Sabinus und der Vatinia Primigenia
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des M. Volusius Iuvencus und der Equilia (Weinhändler); Casa del Fabbro mit (n. Erdb.?).;
Gebäude I 10, 8
(ID 1383)
Fläche: 266 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a
Name(n)
Casa dei Minucii; Haus und textrina des Minucius Fuscus und der Epaphra
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus und textrina des Minucius Fuscus und der Epaphra. Haus der Minuci, des Minucius Fuscus und des Myrmillo Minucius (Exgladiator?).;
Gebäude I 10, 9
(ID 1384)
Fläche: 8 qm
Räume
1
Name(n)
Taberna di P.C.F.
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt des P. C. F., gemäß dem Ladenschild: Intarsienleger?;
Gebäude I 10, 10.11
(ID 1385)
Fläche: 441 qm
Räume
1, 10S1, 11, 12, 13S1, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 27, 3, 34/7, 4, 5, 6S1, 7S1, 8, 9, 98S1, 99S1, 9c, a
Name(n)
Casa degli amanti; Haus des Ti. Claudius Eulogos
Kategorien
Atriumhaus; Bordell; Handel und Gewerbe; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Ti. Claudius Eulogos, Kaufmann (?) (griech. Freigelassener des Kaiserhauses); Casa degli amanti mit Lupanar?;
Gebäude I 10, 12
(ID 1386)
Fläche: 22 qm
Räume
31b
Name(n)
Officina (?), latrina (?)
Kategorien
Gastronomie; Handel und Gewerbe; Latrinen; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Werkstatt? Öffentliche Latrine?;
Gebäude I 10, 13
(ID 1387)
Fläche: 20 qm
Räume
1
Name(n)
Caupona di Q. Poppaeus
Kategorien
caupona; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Poppaeorum caupona des Q. Poppaeus Eros?;
Gebäude I 10, 18
(ID 1392)
Fläche: 92 qm
Räume
1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa degli Aufidii; Haus des Aufidius Primus und der Suilimea
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Aufidius Primus und der Suilimea-, Haus der Aufidii, Primus und Ampliatus.;
Gebäude I 11, 1.2
(ID 1393)
Fläche: 172 qm
Räume
-
Name(n)
caupona Stabilionis
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft; thermopolium; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona Stabilionis (Eigentümer Actius), thermopolium, mit Handwerksbetrieb im OG und Wohnung.;
Gebäude I 11, 3
(ID 1394)
Fläche: 45 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega o officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden oder Werkstatt ohne Einbauten.;
Gebäude I 11, 4
(ID 1395)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleiner Laden ohne Einbauten mit Mezzaningeschoß.;
Gebäude I 11, 13
(ID 1401)
Fläche: 159 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Reihenhaus.;
Gebäude I 11, 14
(ID 1402)
Fläche: 221 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Cherem
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Cherem, Haus eines Hebräers.;
Gebäude I 11, 16
(ID 1404)
Fläche: 152 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Saturninus
Kategorien
Atriumhaus; Gastwirtschaft; Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: hospitium mit Restaurant. Davor locus des Saturnitius und des Gaphyrus; Wahlinschrift: (Emptores). cuncti rog.;
Gebäude I 11, 17
(ID 1405)
Fläche: 114 qm
Räume
-
Name(n)
Casa Imperiale
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa Imperiale;
Gebäude I 12, 3
(ID 1407)
Fläche: 144 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona all'Insegna di Roma; Restaurant und Eisenwarenhandlung (?) des Sotericus
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Restaurant und Eisenwarenhandlung (?) des Sotericus; caupona all'Insegna di Roma.;
Gebäude I 12, 4
(ID 1408)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega e officina (di un musivarius?)
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden; Werkstatt
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden und Werkstatt eines musivarius (?), eines Filzmachers?;
Gebäude I 12, 5
(ID 1409)
Fläche: 152 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona des Lutatius; Osteria all'Insegna di Africa o di Alessandria
Kategorien
Atriumhaus; caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona des Lutatius. Osteria all'Insegna di Africa o di Alessandria.;
Gebäude I 12, 6
(ID 1410)
Fläche: 332 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hofhaus.;
Gebäude I 12, 7
(ID 1411)
Fläche: 165 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Wohnhaus.;
Gebäude I 12, 8
(ID 1412)
Fläche: 382 qm
Räume
-
Name(n)
Casa del Garum degli Umbricii
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa del Garum, Officina degli Umbricii.;
Gebäude I 12, 15
(ID 1416)
Fläche: 307 qm
Räume
-
Name(n)
Casa della Medusa
Kategorien
Atriumhaus; Garten
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Casa della Medusa, kleines Haus mit großem Garten.;
Gebäude I 12, 16
(ID 1417)
Fläche: 145 qm
Räume
-
Name(n)
Haus mit dem gemalten labrum
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus mit dem gemalten labrum.;
Gebäude I 13, 1
(ID 1418)
Fläche: 252 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di T. Crassius Crescens
Kategorien
Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des T. Crassius Crescens (Firrnus), der Tiberii-Crassi Crescenti und Firmi.;
Gebäude I 13, 3
(ID 1420)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
Casa con officina
Kategorien
Handel und Gewerbe; Werkstatt; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus mit (Schuster-?) Werkstatt und Wohnung des Lesbianus? ;
Gebäude I 13, 7
(ID 1422)
Fläche: 151 qm
Räume
-
Name(n)
Hospitium
Kategorien
Atriumhaus; Herberge; Hospitium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: hospitium.;
Gebäude I 13, 8
(ID 1423)
Fläche: 154 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
Atriumhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Privathaus.;
Gebäude I 13, 9
(ID 1424)
Fläche: 480 qm
Räume
-
Name(n)
Casa di Lesbianus e Numicia Primigenia; Haus der Venus Marina
Kategorien
Atriumhaus; Garten; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus des Lesbianus und der Numicia Primigenia; Haus der Venus Marina. Landhaus mit großem Garten mit erhaltenem OG.;
Gebäude I 13, 10
(ID 1425)
Fläche: 38 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Lebensmittel
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lebensmittelgeschäft.;
Gebäude I 13, 11
(ID 1426)
Fläche: 143 qm
Räume
-
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Hofhaus.;
Gebäude I 13, 15
(ID 1427)
Fläche: 75 qm
Räume
-
Name(n)
Stalla (?), magazzino (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Einfahrt mit Stall? Warenlager? (x);
Gebäude I 13, 16
(ID 1428)
Fläche: 129 qm
Räume
-
Name(n)
Caupona
Kategorien
caupona; Gastronomie; Gastwirtschaft
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: caupona.;
Gebäude VII 4, 3
(ID 1474)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Länglicher Laden (Verkauf von Terrakottawaren?);
Gebäude VII 4, 5
(ID 1475)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Scala
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Separate Treppe zum OG.;
Gebäude VII 4, 9
(ID 1476)
Fläche: 27 qm
Räume
-
Name(n)
Taberna di Euhodus
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden des Euhodus? Taberna vitrea.;
Gebäude VII 4, 23.24.25
(ID 1477)
Fläche: 292 qm
Räume
-
Name(n)
Officina olearia dei Numisii, Iucundus, Secundus e Victor
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Geschäftshaus. Officina olearia des Sex. Numisius Jucundus mit Secundus und Victor (mercatores oleari); der Numisii, Sextus und Secundus; Casa detta di Sileno.;
Gebäude VII 6, 34.35.36
(ID 1479)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
Lupanar der Venus; Taberna lusoria
Kategorien
Bordell; Handel und Gewerbe
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Lupanar der Venus, mit Mystis, Rufa, Restituta, Quintilla, Veneria, Chloe puellae. Taberna lusoria aleariorum, Pächter der Siculer Castresis?;
Gebäude VII 7, 1
(ID 1480)
Fläche: 37 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden.;
Gebäude VII 9, 57
(ID 1481)
Fläche: 33 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium, Bottega (?)
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: thermopolium, Popina;
Gebäude VII 12, 29
(ID 1483)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Latrina
Kategorien
Latrinen
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Öffentliche Latrine.;
Gebäude VI 12, 4
(ID 1484)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit r. gemauerter Treppe zum OG (11 Stufen erhalten), r. hinten überwölbtes lararium, apotheca unter der Treppe.;
Gebäude VI 12, 6
(ID 1485)
Fläche: 25 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden mit l. hinten Herd mit Larennische, Mitte Brunnen, r. Treppe zum HG, davor und an der Vorderwand Nischen (Schränke?).;
Gebäude IX 1, 8
(ID 1487)
Fläche: 56 qm
Räume
a, b, c
Name(n)
Popina e thermopolium
Kategorien
Gastwirtschaft; thermopolium
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Popina und thermopolium;
Gebäude IX 1, 21
(ID 1488)
Fläche: 15 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega
Kategorien
Handel und Gewerbe; Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Haushaltswaren).;
Gebäude IX 9, 11
(ID 1491)
Fläche: 173 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g, h, i
Name(n)
Casa
Kategorien
Garten
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Reihenhaus, Garten mit bacchischem Charakter.;
Gebäude IX 13, 3.2.1
(ID 1492)
Fläche: 778 qm
Räume
-
Name(n)
Haus der CC. Julii; Haus Gustaf VI. Adolf von Schweden
Kategorien
Handel und Gewerbe; Herberge; Hospitium; Laden; Wohnhaus
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Haus der CC. Julii, Polybius und Philippus (?) mit Wohnung des M. Sextilius L., Laden des negotiator aerarius Phrynicus (Prunicus). Haus Gustaf VI. Adolf von Schweden. Evtl. hospitium.;
Gebäude IX 1,
(ID 1497)
Fläche: 48 qm
Räume
a, b, c, d
Name(n)
Casa con bottega
Kategorien
Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Kleines Geschäftshaus mit Laden (Haushalts- und Kunstgegenstände).; 397
Gebäude IX 1, 28
(ID 1498)
Fläche: 90 qm
Räume
a, b, c, d, e, f, g
Name(n)
Stalla
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: stabulum des (L. Albucius?) Thesmus lib., mulio oder iumentarius. Einfahrt für Karren, dahinter 2 cubicula für Stallknechte, l. am Stützpfeiler Treppe zum OG, darunter Latrine. R. großer Pferdestall (vielleicht für die Tiere von 22?).; 404
Gebäude IX 14, d
(ID 1503)
Fläche: 167 qm
Räume
1, 10, 11, 2, 3, 4, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- SLuecke: Kein Eintrag in Eschebach 1993 (auf S. 452);
Gebäude VII 2, 28
(ID 1505)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Cella meretricia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: cella meretricia mit gemauertem Bett und Blumenständer (32. 33?).;
Gebäude VIII 7, 26
(ID 1506)
Fläche: 705 qm
Räume
1, 11, 12, 13, 13a, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di Popidius Natalis, sacerdote d'Iside
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- : Wohnhaus mit Magazinen. Haus des M. Popidius Natalis, Isis-Priester.;
Gebäude I 15, 5
(ID 1507)
Fläche: 39 qm
Räume
-
Name(n)
Stalla
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Stall: Eingang zu 3 verbundenen Räumen, l. Treppe zum OG.;
Gebäude VIII 7, 33
(ID 1509)
Fläche: 10 qm
Räume
5
Name(n)
Schola et horologium di L. Sepunius Sandilianus e M. Herennius Epidianus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Im NW des Tempels halbrunde Tuff-Schola mit Sonnenuhr des L. Sepunius Sandilianus und des M. Herrennius Epdianus.;
Gebäude VIII 7, 34
(ID 1510)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Heroon
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Heroon (eines sagenhaften Stadtgründers - Herakles?).;
Gebäude VII 7, 4
(ID 1511)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
Laden
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: Laden (Metallwaren: kleine Gegenstände aus Bronze).;
Gebäude VIII 1, A
(ID 1513)
Fläche: 4427 qm
Räume
-
Name(n)
Villa des Ikarus; Villa Imperiale
Kategorien
Villa suburbana
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
- Eschebach 1993: Villa Suburbana. 'Villa Imperiale'. Villa des Ikaros.; SLuecke: Bezeichnung "Villa des Ikaros" motiviert durch ein Wandgemälde in der Villa, das den Sturz des Ikaros zeigt (Abb. bei PIP).;
Gebäude VI 1a, 1
(ID 1514)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 2
(ID 1515)
Fläche: 16 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des T. Terentius Felix Maior; Tomba di T. Terentius Felix Maior
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 3
(ID 1516)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person; Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 4
(ID 1518)
Fläche: 45 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person; Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 5
(ID 1519)
Fläche: 38 qm
Räume
-
Name(n)
Grab (des N. Curtius N. F. Spurianus?); Tomba (di N. Curtius N. F. Spurianus?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 6
(ID 1520)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba delle ghirlande
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 7
(ID 1521)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person; Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 8
(ID 1522)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba del vaso di vetro blu
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 9
(ID 1523)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba (cenotafo?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 10
(ID 1524)
Fläche: 43 qm
Räume
-
Name(n)
Officina e casa
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 11
(ID 1525)
Fläche: 46 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio o officina di carradore
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 16
(ID 1528)
Fläche: 45 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 17
(ID 1529)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 18
(ID 1530)
Fläche: 48 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 19
(ID 1531)
Fläche: 44 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio o statio mulionum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 20
(ID 1532)
Fläche: 41 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio (laboratorio di produzione polimetallica?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 20A
(ID 1533)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Tre bacini, cisterna
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 21
(ID 1534)
Fläche: 42 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 22
(ID 1535)
Fläche: 42 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 23
(ID 1536)
Fläche: 41 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 24
(ID 1537)
Fläche: 42 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 25
(ID 1538)
Fläche: 41 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 26
(ID 1539)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 27
(ID 1540)
Fläche: 41 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 28
(ID 1541)
Fläche: 38 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio (o stalla?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 31
(ID 1544)
Fläche: 16 qm
Räume
-
Name(n)
Nove tombe semplici
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 32
(ID 1545)
Fläche: 16 qm
Räume
-
Name(n)
Sette tombe
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 33
(ID 1547)
Fläche: 11 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 34
(ID 1548)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba di L. Caltilius L. L. Pamphilus e Servilia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 35
(ID 1549)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 36
(ID 1550)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 37
(ID 1551)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba degli Allei
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 40
(ID 1552)
Fläche: 1 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba a nicchia di Salvius
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 41
(ID 1553)
Fläche: 1 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba a nicchia di N. Velasius Gratus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 42
(ID 1554)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba a podio di M. Arrius Diomedes
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, 43
(ID 1555)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Tombe di M. Arrius Diomedes e Arria
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 1
(ID 1557)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba di M. Cerrinius Restitutus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 2
(ID 1558)
Fläche: 17 qm
Räume
-
Name(n)
Schola tomba di Aulus Veius M. F. o Sedile di A. Veio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 3
(ID 1559)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba di M. Porcius
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 4
(ID 1560)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Schola tomba di Mammia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 5
(ID 1561)
Fläche: 22 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 6
(ID 1562)
Fläche: 47 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 7
(ID 1563)
Fläche: 29 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium o negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 8
(ID 1564)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 9
(ID 1565)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 10
(ID 1566)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 11
(ID 1567)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 12
(ID 1568)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 13
(ID 1569)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 14
(ID 1570)
Fläche: 18 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium o negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 15
(ID 1571)
Fläche: 14 qm
Räume
-
Name(n)
Negozio
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 16
(ID 1572)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Tomb of Tyche, slave of Julia Augusta
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 17
(ID 1573)
Fläche: 40 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba (di Numerius Festius Ampliatus? Di Aulus Umbricius Scaurus?
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 18
(ID 1574)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba (di Caius Fabius Secundus?
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 19
(ID 1575)
Fläche: 94 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 20
(ID 1576)
Fläche: 26 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba di C. Calventius Quietus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 21
(ID 1577)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba di Numerius Istacidius Helenus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 22
(ID 1578)
Fläche: 33 qm
Räume
-
Name(n)
Tomba di Naevoleia Tyche e C. Munatius Faustus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 23
(ID 1579)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Triclinium funebre di Cn. Vibrius Saturninus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 17a, 24.25
(ID 1581)
Fläche: 2862 qm
Räume
-
Name(n)
Villa of Diomedes
Kategorien
Villa suburbana
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
Gebäude VI 17a, 4A
(ID 1582)
Fläche: 16 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 1
(ID 1588)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 17
(ID 1589)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 3
(ID 1590)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des L. Ceius Serapio und seiner Frau Helvia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 19
(ID 1591)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 5
(ID 1592)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Grab von Aulus Clodius Iustus, Aulus Clodius Aegialus, Tironia Repentina, Clodia Nigella, Aulus Clodius Faustus, Aulus Clodius Pompeianus, Clodia Auli, Lucidus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 21
(ID 1593)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 7
(ID 1594)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des Publius Flavius Philoxsenus und der Flavia Agathea, des Acastus und Spiron
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 23
(ID 1595)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Aedicula-Grab von Publius Vesonius Phileros, Vesonia und Marcus Orfellius Faustus, Publius Vesonius Pileros, Publius Vesonius Proculus, Vesonia Urbana, Eliodorus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 9
(ID 1596)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Grab eines Magistrats (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 25
(ID 1597)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 11
(ID 1598)
Fläche: 168 qm
Räume
-
Name(n)
Grab der Eumachia, des Lucius Eumachius Aprilis, Cneius Alleius Eroti, Cneius Alleius Logus und der Pomponia Decharcis
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 27
(ID 1599)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des Aulus Campius Antiocus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 13
(ID 1600)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des Marcus Octavius und der Vertia Philumina
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 29
(ID 1601)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des Lucius Caesius und der Annedia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 15
(ID 1602)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des Caius Minatius Iucundus und der Antistia M L Auxesis
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude I 20a, 31
(ID 1603)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Grab von Marcus Stronnius Meinius, Stronnia Acatarchis, Caius Stronnius, pater, und Caius Stronnius, filius
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 1
(ID 1619)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 2
(ID 1620)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab mit Darstellung einer Jagdszene
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 3
(ID 1621)
Fläche: 23 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 4
(ID 1622)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des L. Cellius
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 5
(ID 1623)
Fläche: 32 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 6
(ID 1624)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten weiblichen Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 7
(ID 1625)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 8
(ID 1626)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Grab der Gens Aninia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 9
(ID 1627)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Grab von Caius Munatius Faustus und Naevoleia Tyche, Lucio Naevoleius Eutrapelus, Munatia Euche, Helpis, Primigenia, Arsinoe, Psiche und Atimetus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 10
(ID 1628)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 11
(ID 1629)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Grab eines Soldaten
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 12
(ID 1630)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person (L. Hadonina?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 13
(ID 1631)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab von Aulus Veius Atticus, Aulus Veius Nymphius mit einer runden Marmorscheibe des Marcus Herrenius Epidianus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 14
(ID 1632)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person (mit Gladiator-Graffiti)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 15
(ID 1633)
Fläche: 19 qm
Räume
-
Name(n)
Grab von Lucius Barbidius Communis and Pithia Rufilla, Acris, Aulus Dentatius Fortunatus, Aulus Dentatius Felix, Aulo Dentatio A. L. Celso, Pompeia Aucta, L. Barbidio Vitali, Vitalis, Ianuarius
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 16
(ID 1634)
Fläche: 13 qm
Räume
-
Name(n)
Grab des Numerius Alleius Auctus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 17
(ID 1635)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab der Caius Cuspius Cyrus, Caius Cuspius Salvius und Vesvia Iucunda
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 18
(ID 1636)
Fläche: 9 qm
Räume
-
Name(n)
Grab (Ustrinum?) einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 19
(ID 1637)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 20
(ID 1638)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Grab (Tetrapylon)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 34
(ID 1639)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Grab (der Afrea Prima?), mit acht Cippi
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 22
(ID 1640)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Grab der Lucius Publicius Syneros, Aebia Fausta, Lucius Aebius Aristo und Aebia Hilara
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 34a
(ID 1641)
Fläche: 3 qm
Räume
-
Name(n)
Aedicula-Grab mit floraler Stuckdekoration und drei Statuen
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 24
(ID 1642)
Fläche: 12 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 36
(ID 1643)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
Grab (mit vier kleinen Säulen) einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 26
(ID 1644)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 38
(ID 1645)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 28
(ID 1646)
Fläche: 2 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 40
(ID 1647)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten weiblichen Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 30
(ID 1648)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab der Melissaea, Tochter des Numerius Melissaeus, und zweier M. Servilius (Vater und Sohn)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 42
(ID 1649)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Grab der Derecia Methe
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 32
(ID 1650)
Fläche: 8 qm
Räume
-
Name(n)
Grab (des Lucius Sepunius Sandilianus?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 8a, 44
(ID 1651)
Fläche: 5 qm
Räume
-
Name(n)
Grab einer unbekannten Person
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude
(ID 1655)
Fläche: 2175 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27a, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4b, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54a, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 63a, 63b, 63c, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 71a, 71b, 71c, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77a, 78, 78a, 79, 79A, 79b, 79c, 79d, 79e, 8, 80, 81, 82, 82a, 82b, 82b1, 82c, 82c1, 83, 84, 85, 8a, 9
Name(n)
Villa dei Misteri
Kategorien
Villa suburbana
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
Gebäude IX 12, A.9
(ID 1656)
Fläche: 754 qm
Räume
1, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, u
Name(n)
Casa dei "Pittori al Lavoro"
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Luecke 2025: Casa dei "Pittori al Lavoro". Ausgrabungen 2024 (s. E-Journal 26, 24.10.2024, fig. 1.) ;
Gebäude VIII 7,
(ID 1657)
Fläche: 11 qm
Räume
7
Name(n)
Puteus, puteale di M. Numerius Trebius
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude Castellum (Wasserkastell),
(ID 1658)
Fläche: 49 qm
Räume
-
Name(n)
Castellum Aquae
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
Gebäude VII 4, 62
(ID 1659)
Fläche: 120 qm
Räume
-
Name(n)
Casa delle Forme di Creta
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Eschebach 1993: 2 miteinander verbundene Häuser der gens Tullia mit Läden: 59 Haus eines Bronze-Großhändlers; Casa dei Bronzi; Casa della Parete nera; 62: Wohnhaus des L. Tullius Faustus, (Marmorimporteur'?) mit Stukkateur-Werkstatt (vgl. auch oben unter 2: Werkstatt eines marmorarius); Casa delle Forme di Creta.; Strocka 2000: Strocka, Volker Michael (Hrsg.) (1984ff.): Häuser in Pompeji: Casa della Parete nera (VII 4, 58 - 60) und Casa delle Forme di creta (VII 4, 61 - 63) [2000];
Gebäude VII 4, 58
(ID 1661)
Fläche: 31 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega sannitica
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 4, 63
(ID 1662)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 5
(ID 1664)
Fläche: 11 qm
Räume
l
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 7
(ID 1665)
Fläche: 10 qm
Räume
k
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 13, 14
(ID 1667)
Fläche: 15 qm
Räume
-
Name(n)
Bottega
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VIII 4, 28
(ID 1668)
Fläche: 19 qm
Räume
a
Name(n)
Bottega (vendita di farina?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude IX 12, B
(ID 1669)
Fläche: 170 qm
Räume
1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Name(n)
Casa di Fedra; House of Phaedra
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
- Luecke 2025: Ehedem zur benachbarten Casa dei "Pittori al Lavoro" gezählt. Vorläufig bezeichnet als "Casa di Fedra" bzw. "House of Phaedra";
Gebäude VII 11, 12
(ID 1670)
Fläche: 4 qm
Räume
-
Name(n)
Cella meretricia
Kategorien
Bordell
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VIII 2, 10
(ID 1671)
Fläche: 125 qm
Räume
-
Name(n)
Edificio civile, Sala dei Duumviri
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VIII 2, 8
(ID 1672)
Fläche: 137 qm
Räume
-
Name(n)
Tempio J
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VIII 2, 7
(ID 1674)
Fläche: 56 qm
Räume
-
Name(n)
Angiportus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VIII 2, 9
(ID 1675)
Fläche: 10 qm
Räume
-
Name(n)
Angiportus
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VIII 2,
(ID 1676)
Fläche: 47 qm
Räume
-
Name(n)
Spazio attiguo alla curia
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 8,
(ID 1677)
Fläche: 149 qm
Räume
-
Name(n)
Thermopolium
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, KL04
(ID 1678)
Fläche: 7 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 1a, KL01
(ID 1680)
Fläche: 6 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude II 3,
(ID 1681)
Fläche: 105 qm
Räume
-
Name(n)
Officina vasaria
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude III 9, 4
(ID 1682)
Fläche: 20 qm
Räume
-
Name(n)
Officina (?)
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 8,
(ID 1683)
Fläche: 5160 qm
Räume
-
Name(n)
Forum
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
PIP, Google Maps
Kommentar
Gebäude VI 10, 14
(ID 1685)
Fläche: 232 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 5,
(ID 1687)
Fläche: 354 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 5,
(ID 1688)
Fläche: 344 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 4, 2
(ID 1689)
Fläche: 104 qm
Räume
-
Name(n)
-
Kategorien
-
Funde
-
Externe Links
Kommentar
Gebäude IX 10, 1
(ID Gebäude: 1122)
Raum N/A (Sondernutzung)
(ID Raum: 1)
Fläche: 92 qm
Externe Links
Pompeiisites
Kommentar
- Bankettsaal, entdeckt bei Ausgrabungen 2023/4
Gebäude IX 10, 1
(ID Gebäude: 1122)
Raum N/A (Sondernutzung)
(ID Raum: 2)
Fläche: 8 qm
Externe Links
Kommentar
- Raum mit blauen Wänden mit Darstellungen von weiblichen Figuren. "Sacrarium" (?). Im Raum wurden auch Amphoren gefunden.
Gebäude IX 10, 1
(ID Gebäude: 1122)
Raum N/A (Allgemein)
(ID Raum: 3)
Fläche: 5 qm
Externe Links
Kommentar
- Vestibül, Vorraum des "Sacrariums (?)"
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum e (-)
(ID Raum: 3657)
Fläche: 17 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum h-3 (-)
(ID Raum: 3664)
Fläche: 26 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum i (-)
(ID Raum: 3665)
Fläche: 6 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum k (-)
(ID Raum: 3666)
Fläche: 5 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum l (-)
(ID Raum: 3667)
Fläche: 4 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum m (-)
(ID Raum: 3668)
Fläche: 4 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum n (-)
(ID Raum: 3669)
Fläche: 37 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum o (-)
(ID Raum: 3670)
Fläche: 15 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VII 3, 1.2.3.38.39.40
(ID Gebäude: 565)
Raum p (-)
(ID Raum: 3671)
Fläche: 27 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 12, 1.2.3.5.7.8
(ID Gebäude: 390)
Raum 1 (-)
(ID Raum: 3733)
Fläche: 37 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 12, 1.2.3.5.7.8
(ID Gebäude: 390)
Raum 2 (-)
(ID Raum: 3734)
Fläche: 21 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 12, 1.2.3.5.7.8
(ID Gebäude: 390)
Raum 26 (vestibolo)
(ID Raum: 3759)
Fläche: 6 qm
Externe Links
Kommentar
Gebäude VI 12, 1.2.3.5.7.8
(ID Gebäude: 390)
Raum 53 (fauces)
(ID Raum: 3789)
Fläche: 10 qm
Externe Links
Kommentar
(ID 1)
PIP
(ID 2)
PIP
(ID 3)
PIP
(ID 4)
PIP
(ID 5)
PIP
(ID 6)
PIP
(ID 7)
PIP
(ID 8)
PIP
(ID 9)
PIP
(ID 10)
PIP
(ID 11)
PIP
(ID 12)
PIP
(ID 13)
PIP
(ID 14)
PIP
(ID 15)
PIP
(ID 16)
PIP
(ID 17)
PIP
(ID 18)
PIP
(ID 19)
PIP
(ID 20)
PIP
(ID 21)
PIP
(ID 22)
PIP
(ID 23)
PIP
(ID 24)
PIP
(ID 25)
PIP
(ID 26)
PIP
(ID 27)
PIP
(ID 28)
PIP
(ID 29)
PIP
(ID 30)
PIP
(ID 31)
PIP
(ID 32)
PIP
(ID 33)
PIP
(ID 34)
PIP
(ID 35)
PIP
(ID 36)
PIP
(ID 37)
PIP
(ID 38)
PIP
(ID 39)
PIP
(ID 40)
PIP
(ID 41)
PIP
(ID 42)
PIP
(ID 43)
PIP
(ID 44)
PIP
(ID 45)
PIP
(ID 46)
PIP
(ID 47)
PIP
(ID 48)
PIP
(ID 49)
PIP
(ID 50)
PIP
(ID 51)
PIP
(ID 52)
PIP
(ID 53)
PIP
(ID 54)
PIP
(ID 55)
PIP
(ID 56)
PIP
(ID 57)
PIP
(ID 58)
PIP
(ID 59)
PIP
(ID 60)
PIP
(ID 61)
PIP
(ID 62)
PIP
(ID 63)
PIP
(ID 64)
PIP
(ID 65)
PIP
(ID 66)
PIP
(ID 67)
PIP
(ID 68)
PIP
(ID 69)
PIP
(ID 70)
PIP
(ID 71)
PIP
(ID 72)
PIP
(ID 73)
PIP
(ID 74)
PIP
(ID 75)
PIP
(ID 76)
PIP
(ID 77)
PIP
(ID 78)
PIP
(ID 79)
PIP
(ID 80)
PIP
(ID 81)
PIP
(ID 82)
PIP
(ID 83)
PIP
(ID 84)
PIP
(ID 85)
PIP
(ID 86)
PIP
(ID 87)
PIP
(ID 88)
PIP
(ID 89)
PIP
(ID 90)
PIP
(ID 91)
PIP
(ID 92)
PIP
(ID 93)
PIP
(ID 94)
PIP
(ID 95)
PIP
(ID 96)
PIP
(ID 97)
PIP
(ID 98)
PIP
(ID 99)
PIP
(ID 100)
PIP
(ID 101)
PIP
(ID 102)
PIP
(ID 103)
PIP
(ID 104)
PIP
(ID 105)
PIP
(ID 106)
PIP
(ID 107)
PIP
(ID 108)
PIP
(ID 109)
PIP
(ID 110)
PIP
(ID 111)
PIP
(ID 112)
PIP
(ID 113)
PIP
(ID 114)
PIP
(ID 115)
PIP
(ID 116)
PIP
(ID 117)
PIP
(ID 118)
PIP
(ID 119)
PIP
(ID 120)
PIP
(ID 121)
PIP
(ID 122)
PIP
(ID 123)
PIP
(ID 124)
PIP
(ID 125)
PIP
(ID 126)
PIP
(ID 127)
PIP
(ID 128)
PIP
(ID 129)
PIP
(ID 130)
PIP
(ID 131)
PIP
(ID 132)
PIP
(ID 133)
PIP
(ID 134)
PIP
(ID 135)
PIP
(ID 136)
PIP
(ID 137)
PIP
(ID 138)
PIP
(ID 139)
PIP
(ID 140)
PIP
(ID 141)
PIP
(ID 142)
PIP
(ID 143)
PIP
(ID 144)
PIP
(ID 145)
PIP
(ID 146)
PIP
(ID 147)
PIP
(ID 148)
PIP
(ID 149)
PIP
(ID 150)
PIP
(ID 151)
PIP
(ID 152)
PIP
(ID 153)
PIP
(ID 154)
PIP
(ID 155)
PIP
(ID 156)
PIP
(ID 157)
PIP
(ID 158)
PIP
(ID 159)
PIP
(ID 160)
PIP
(ID 161)
PIP
(ID 162)
PIP
(ID 163)
PIP
(ID 164)
PIP
(ID 165)
PIP
(ID 166)
PIP
(ID 167)
PIP
(ID 168)
PIP
(ID 169)
PIP
(ID 170)
PIP
(ID 171)
PIP
(ID 172)
PIP
(ID 173)
PIP
(ID 174)
PIP
(ID 175)
PIP
(ID 176)
PIP
(ID 177)
PIP
(ID 178)
PIP
(ID 179)
PIP
(ID 180)
PIP
(ID 181)
PIP
(ID 182)
PIP
(ID 183)
PIP
(ID 184)
PIP
(ID 185)
PIP
(ID 186)
PIP
(ID 187)
PIP
(ID 188)
PIP
(ID 189)
PIP
(ID 190)
PIP
(ID 191)
PIP
(ID 192)
PIP
(ID 193)
PIP
(ID 194)
PIP
(ID 195)
PIP
(ID 196)
PIP
(ID 197)
PIP
(ID 198)
PIP
(ID 199)
PIP
(ID 200)
PIP
(ID 201)
PIP
(ID 202)
PIP
(ID 203)
PIP
(ID 204)
PIP
(ID 205)
PIP
(ID 206)
PIP
(ID 207)
PIP
(ID 208)
PIP
(ID 209)
PIP
(ID 210)
PIP
(ID 211)
PIP
(ID 212)
PIP
(ID 213)
PIP
(ID 214)
PIP
(ID 215)
PIP
(ID 216)
PIP
(ID 217)
PIP
(ID 218)
PIP
(ID 219)
PIP
(ID 220)
PIP
(ID 221)
PIP
(ID 222)
PIP
(ID 223)
PIP
(ID 224)
PIP
(ID 225)
PIP
(ID 226)
PIP
(ID 227)
PIP
(ID 228)
PIP
(ID 229)
PIP
(ID 230)
PIP
(ID 231)
PIP
(ID 232)
PIP
(ID 233)
PIP
(ID 234)
PIP
(ID 235)
PIP
(ID 236)
PIP
(ID 237)
PIP
(ID 238)
PIP
(ID 239)
PIP
(ID 240)
PIP
(ID 241)
PIP
(ID 242)
PIP
(ID 243)
PIP
(ID 244)
PIP
(ID 245)
PIP
(ID 246)
PIP
(ID 247)
PIP
(ID 248)
PIP
(ID 249)
PIP
(ID 250)
PIP
(ID 251)
PIP
(ID 252)
PIP
(ID 253)
PIP
(ID 254)
PIP
(ID 255)
PIP
(ID 256)
PIP
(ID 257)
PIP
(ID 258)
PIP
(ID 259)
PIP
(ID 260)
PIP
(ID 261)
PIP
(ID 262)
PIP
(ID 263)
PIP
(ID 264)
PIP
(ID 265)
PIP
(ID 266)
PIP
(ID 267)
PIP
(ID 268)
PIP
(ID 269)
PIP
(ID 270)
PIP
(ID 271)
PIP
(ID 272)
PIP
(ID 273)
PIP
(ID 274)
PIP
(ID 275)
PIP
(ID 276)
PIP
(ID 277)
PIP
(ID 278)
PIP
(ID 279)
PIP
(ID 280)
PIP
(ID 281)
PIP
(ID 282)
PIP
(ID 283)
PIP
(ID 284)
PIP
(ID 285)
PIP
(ID 286)
PIP
(ID 287)
PIP
(ID 288)
PIP
(ID 289)
PIP
(ID 290)
PIP
(ID 291)
PIP
(ID 292)
PIP
(ID 293)
PIP
(ID 294)
PIP
(ID 295)
PIP
(ID 296)
PIP
(ID 297)
PIP
(ID 298)
PIP
(ID 299)
PIP
(ID 300)
PIP
(ID 302)
PIP
(ID 303)
PIP
(ID 304)
PIP
(ID 305)
PIP
(ID 306)
PIP
(ID 307)
PIP
(ID 308)
PIP
(ID 309)
PIP
(ID 310)
PIP
(ID 311)
PIP
(ID 312)
PIP
(ID 313)
PIP
(ID 314)
PIP
(ID 315)
PIP
(ID 316)
PIP
(ID 317)
PIP
(ID 318)
PIP
(ID 319)
PIP
(ID 320)
PIP
(ID 321)
PIP
(ID 322)
PIP
(ID 323)
PIP
(ID 324)
PIP
(ID 325)
PIP
(ID 326)
PIP
(ID 327)
PIP
(ID 328)
PIP
(ID 329)
PIP
(ID 330)
PIP
(ID 331)
PIP
(ID 332)
PIP
(ID 333)
PIP
(ID 334)
PIP
(ID 335)
PIP
(ID 336)
PIP
(ID 337)
PIP
(ID 338)
PIP
(ID 339)
PIP
(ID 340)
PIP
(ID 341)
PIP
(ID 342)
PIP
(ID 343)
PIP
(ID 344)
PIP
(ID 346)
PIP
(ID 347)
PIP
(ID 348)
PIP
(ID 349)
PIP
(ID 351)
PIP
(ID 352)
PIP
(ID 353)
PIP
(ID 354)
PIP
(ID 355)
PIP
(ID 356)
PIP
(ID 357)
PIP
(ID 358)
PIP
(ID 359)
PIP
(ID 360)
PIP
(ID 363)
PIP
(ID 364)
PIP
(ID 365)
PIP
(ID 366)
PIP
(ID 367)
PIP
(ID 368)
PIP
(ID 369)
PIP
(ID 370)
PIP
(ID 371)
PIP
(ID 372)
PIP
(ID 373)
PIP
(ID 374)
PIP
(ID 376)
PIP
(ID 377)
PIP
(ID 378)
PIP
(ID 379)
PIP
(ID 380)
PIP
(ID 381)
PIP
(ID 382)
PIP
(ID 383)
PIP
(ID 384)
PIP
(ID 385)
PIP
(ID 386)
PIP
(ID 387)
PIP
(ID 388)
PIP
(ID 389)
PIP
(ID 390)
PIP
(ID 391)
PIP
(ID 392)
PIP
(ID 393)
PIP
(ID 394)
PIP
(ID 401)
PIP
(ID 402)
PIP
(ID 403)
PIP
(ID 404)
PIP
(ID 405)
PIP
(ID 406)
PIP
(ID 407)
PIP
(ID 408)
PIP
(ID 409)
PIP
(ID 410)
PIP
(ID 411)
PIP
(ID 412)
PIP
(ID 413)
PIP
(ID 414)
PIP
(ID 415)
PIP
(ID 416)
PIP
(ID 417)
PIP
(ID 418)
PIP
(ID 419)
PIP
(ID 420)
PIP
(ID 421)
PIP
(ID 422)
PIP
(ID 423)
PIP
(ID 424)
PIP
(ID 425)
PIP
(ID 426)
PIP
(ID 427)
PIP
(ID 428)
PIP
(ID 429)
PIP
(ID 430)
PIP
(ID 431)
PIP
(ID 432)
PIP
(ID 433)
PIP
(ID 434)
PIP
(ID 435)
PIP
(ID 436)
PIP
(ID 437)
PIP
(ID 438)
PIP
(ID 439)
PIP
(ID 440)
PIP
(ID 441)
PIP
(ID 442)
PIP
(ID 443)
PIP
(ID 444)
PIP
(ID 445)
PIP
(ID 447)
PIP
(ID 448)
PIP
(ID 449)
PIP
(ID 450)
PIP
(ID 451)
PIP
(ID 452)
PIP
(ID 453)
PIP
(ID 454)
PIP
(ID 455)
PIP
(ID 456)
PIP
(ID 457)
PIP
(ID 458)
PIP
(ID 459)
PIP
(ID 460)
PIP
(ID 461)
PIP
(ID 462)
PIP
(ID 463)
PIP
(ID 464)
PIP
(ID 465)
PIP
(ID 466)
PIP
(ID 467)
PIP
(ID 468)
PIP
(ID 469)
PIP
(ID 470)
PIP
(ID 471)
PIP
(ID 472)
PIP
(ID 473)
PIP
(ID 474)
PIP
(ID 475)
PIP
(ID 476)
PIP
(ID 477)
PIP
(ID 480)
PIP
(ID 481)
PIP
(ID 482)
PIP
(ID 483)
PIP
(ID 484)
PIP
(ID 485)
PIP
(ID 486)
PIP
(ID 487)
PIP
(ID 488)
PIP
(ID 489)
PIP
(ID 490)
PIP
(ID 491)
PIP
(ID 492)
PIP
(ID 493)
PIP
(ID 494)
PIP
(ID 495)
PIP
(ID 496)
PIP
(ID 497)
PIP
(ID 498)
PIP
(ID 499)
PIP
(ID 500)
PIP
(ID 501)
PIP
(ID 502)
PIP
(ID 503)
PIP
(ID 504)
PIP
(ID 505)
PIP
(ID 506)
PIP
(ID 507)
PIP
(ID 508)
PIP
(ID 509)
PIP
(ID 510)
PIP
(ID 511)
PIP
(ID 512)
PIP
(ID 513)
PIP
(ID 514)
PIP
(ID 515)
PIP
(ID 516)
PIP
(ID 517)
PIP
(ID 518)
PIP
(ID 519)
PIP
(ID 520)
PIP
(ID 521)
PIP
(ID 522)
PIP
(ID 523)
PIP
(ID 524)
PIP
(ID 525)
PIP
(ID 526)
PIP
(ID 527)
PIP
(ID 528)
PIP
(ID 529)
PIP
(ID 530)
PIP
(ID 531)
PIP
(ID 532)
PIP
(ID 533)
PIP
(ID 534)
PIP
(ID 535)
PIP
(ID 536)
PIP
(ID 537)
PIP
(ID 538)
PIP
(ID 539)
PIP
(ID 540)
PIP
(ID 541)
PIP
(ID 542)
PIP
(ID 543)
PIP
(ID 544)
PIP
(ID 546)
PIP
(ID 547)
PIP
(ID 548)
PIP
(ID 549)
PIP
(ID 550)
PIP
(ID 551)
PIP
(ID 552)
PIP
(ID 553)
PIP
(ID 554)
PIP
(ID 555)
PIP
(ID 556)
PIP
(ID 557)
PIP
(ID 560)
PIP
(ID 561)
PIP
(ID 562)
PIP
(ID 563)
PIP
(ID 564)
PIP
(ID 565)
PIP
(ID 566)
PIP
(ID 567)
PIP
(ID 568)
PIP
(ID 569)
PIP
(ID 570)
PIP
(ID 571)
PIP
(ID 572)
PIP
(ID 573)
PIP
(ID 574)
PIP
(ID 575)
PIP
(ID 577)
PIP
(ID 578)
PIP
(ID 579)
PIP
(ID 580)
PIP
(ID 581)
PIP
(ID 582)
PIP
(ID 583)
PIP
(ID 584)
PIP
(ID 585)
PIP
(ID 586)
PIP
(ID 587)
PIP
(ID 588)
PIP
(ID 589)
PIP
(ID 590)
PIP
(ID 591)
PIP
(ID 592)
PIP
(ID 593)
PIP
(ID 594)
PIP
(ID 595)
PIP
(ID 596)
PIP
(ID 597)
PIP
(ID 598)
PIP
(ID 599)
PIP
(ID 600)
PIP
(ID 601)
PIP
(ID 602)
PIP
(ID 603)
PIP
(ID 605)
PIP
(ID 606)
PIP
(ID 607)
PIP
(ID 608)
PIP
(ID 609)
PIP
(ID 610)
PIP
(ID 613)
PIP
(ID 614)
PIP
(ID 615)
PIP
(ID 616)
PIP
(ID 617)
PIP
(ID 618)
PIP
(ID 619)
PIP
(ID 620)
PIP
(ID 621)
PIP
(ID 622)
PIP
(ID 623)
PIP
(ID 624)
PIP
(ID 625)
PIP
(ID 626)
PIP
(ID 627)
PIP
(ID 628)
PIP
(ID 629)
PIP
(ID 630)
PIP
(ID 631)
PIP
(ID 632)
PIP
(ID 633)
PIP
(ID 634)
PIP
(ID 635)
PIP
(ID 636)
PIP
(ID 637)
PIP
(ID 638)
PIP
(ID 639)
PIP
(ID 640)
PIP
(ID 641)
PIP
(ID 642)
PIP
(ID 643)
PIP
(ID 644)
PIP
(ID 645)
PIP
(ID 646)
PIP
(ID 647)
PIP
(ID 648)
PIP
(ID 649)
PIP
(ID 650)
PIP
(ID 651)
PIP
(ID 652)
PIP
(ID 653)
PIP
(ID 654)
PIP
(ID 655)
PIP
(ID 656)
PIP
(ID 657)
PIP
(ID 658)
PIP
(ID 659)
PIP
(ID 660)
PIP
(ID 661)
PIP
(ID 662)
PIP
(ID 663)
PIP
(ID 664)
PIP
(ID 665)
PIP
(ID 666)
PIP
(ID 667)
PIP
(ID 668)
PIP
(ID 669)
PIP
(ID 670)
PIP
(ID 671)
PIP
(ID 672)
PIP
(ID 673)
PIP
(ID 674)
PIP
(ID 675)
PIP
(ID 676)
PIP
(ID 677)
PIP
(ID 678)
PIP
(ID 679)
PIP
(ID 680)
PIP
(ID 681)
PIP
(ID 682)
PIP
(ID 683)
PIP
(ID 684)
PIP
(ID 685)
PIP
(ID 686)
PIP
(ID 687)
PIP
(ID 688)
PIP
(ID 689)
PIP
(ID 690)
PIP
(ID 691)
PIP
(ID 692)
PIP
(ID 693)
PIP
(ID 694)
PIP
(ID 695)
PIP
(ID 696)
PIP
(ID 697)
PIP
(ID 698)
PIP
(ID 699)
PIP
(ID 700)
PIP
(ID 701)
PIP
(ID 702)
PIP
(ID 703)
PIP
(ID 704)
PIP
(ID 705)
PIP
(ID 706)
PIP
(ID 707)
PIP
(ID 708)
PIP
(ID 709)
PIP
(ID 710)
PIP
(ID 711)
PIP
(ID 712)
PIP
(ID 713)
PIP
(ID 714)
PIP
(ID 715)
PIP
(ID 716)
PIP
(ID 717)
PIP
(ID 718)
PIP
(ID 719)
PIP
(ID 720)
PIP
(ID 721)
PIP
(ID 722)
PIP
(ID 723)
PIP
(ID 724)
PIP
(ID 725)
PIP
(ID 726)
PIP
(ID 727)
PIP
(ID 728)
PIP
(ID 729)
PIP
(ID 730)
PIP
(ID 731)
PIP
(ID 732)
PIP
(ID 733)
PIP
(ID 734)
PIP
(ID 735)
PIP
(ID 736)
PIP
(ID 737)
PIP
(ID 738)
PIP
(ID 739)
PIP
(ID 740)
PIP
(ID 741)
PIP
(ID 742)
PIP
(ID 743)
PIP
(ID 744)
PIP
(ID 745)
PIP
(ID 746)
PIP
(ID 747)
PIP
(ID 748)
PIP
(ID 749)
PIP
(ID 750)
PIP
(ID 751)
PIP
(ID 752)
PIP
(ID 753)
PIP
(ID 754)
PIP
(ID 755)
PIP
(ID 756)
PIP
(ID 757)
PIP
(ID 758)
PIP
(ID 759)
PIP
(ID 760)
PIP
(ID 761)
PIP
(ID 762)
PIP
(ID 763)
PIP
(ID 764)
PIP
(ID 765)
PIP
(ID 766)
PIP
(ID 767)
PIP
(ID 768)
PIP
(ID 769)
PIP
(ID 770)
PIP
(ID 771)
PIP
(ID 772)
PIP
(ID 773)
PIP
(ID 774)
PIP
(ID 775)
PIP
(ID 776)
PIP
(ID 777)
PIP
(ID 778)
PIP
(ID 779)
PIP
(ID 780)
PIP
(ID 781)
PIP
(ID 782)
PIP
(ID 783)
PIP
(ID 784)
PIP
(ID 785)
PIP
(ID 786)
PIP
(ID 787)
PIP
(ID 788)
PIP
(ID 789)
PIP
(ID 790)
PIP
(ID 791)
PIP
(ID 792)
PIP
(ID 793)
PIP
(ID 794)
PIP
(ID 795)
PIP
(ID 796)
PIP
(ID 797)
PIP
(ID 798)
PIP
(ID 799)
PIP
(ID 800)
PIP
(ID 801)
PIP
(ID 802)
PIP
(ID 803)
PIP
(ID 804)
PIP
(ID 805)
PIP
(ID 806)
PIP
(ID 807)
PIP
(ID 808)
PIP
(ID 809)
PIP
(ID 810)
PIP
(ID 811)
PIP
(ID 812)
PIP
(ID 813)
PIP
(ID 814)
PIP
(ID 815)
PIP
(ID 816)
PIP
(ID 817)
PIP
(ID 818)
PIP
(ID 819)
PIP
(ID 820)
PIP
(ID 821)
PIP
(ID 822)
PIP
(ID 823)
PIP
(ID 824)
PIP
(ID 825)
PIP
(ID 826)
PIP
(ID 827)
PIP
(ID 828)
PIP
(ID 829)
PIP
(ID 830)
PIP
(ID 831)
PIP
(ID 832)
PIP
(ID 833)
PIP
(ID 834)
PIP
(ID 835)
PIP
(ID 836)
PIP
(ID 837)
PIP
(ID 838)
PIP
(ID 839)
PIP
(ID 840)
PIP
(ID 841)
PIP
(ID 842)
PIP
(ID 843)
PIP
(ID 844)
PIP
(ID 845)
PIP
(ID 846)
PIP
(ID 847)
PIP
(ID 848)
PIP
(ID 849)
PIP
(ID 850)
PIP
(ID 851)
PIP
(ID 852)
PIP
(ID 853)
PIP
(ID 854)
PIP
(ID 855)
PIP
(ID 856)
PIP
(ID 857)
PIP
(ID 858)
PIP
(ID 859)
PIP
(ID 860)
PIP
(ID 861)
PIP
(ID 862)
PIP
(ID 863)
PIP
(ID 864)
PIP
(ID 865)
PIP
(ID 866)
PIP
(ID 867)
PIP
(ID 868)
PIP
(ID 869)
PIP
(ID 870)
PIP
(ID 871)
PIP
(ID 872)
PIP
(ID 873)
PIP
(ID 874)
PIP
(ID 875)
PIP
(ID 876)
PIP
(ID 877)
PIP
(ID 878)
PIP
(ID 879)
PIP
(ID 880)
PIP
(ID 881)
PIP
(ID 882)
PIP
(ID 883)
PIP
(ID 884)
PIP
(ID 885)
PIP
(ID 886)
PIP
(ID 887)
PIP
(ID 888)
PIP
(ID 889)
PIP
(ID 890)
PIP
(ID 891)
PIP
(ID 892)
PIP
(ID 893)
PIP
(ID 894)
PIP
(ID 895)
PIP
(ID 896)
PIP
(ID 897)
PIP
(ID 898)
PIP
(ID 899)
PIP
(ID 900)
PIP
(ID 901)
PIP
(ID 902)
PIP
(ID 903)
PIP
(ID 904)
PIP
(ID 905)
PIP
(ID 906)
PIP
(ID 907)
PIP
(ID 908)
PIP
(ID 909)
PIP
(ID 910)
PIP
(ID 911)
PIP
(ID 912)
PIP
(ID 913)
PIP
(ID 914)
PIP
(ID 915)
PIP
(ID 916)
PIP
(ID 917)
PIP
(ID 918)
PIP
(ID 919)
PIP
(ID 920)
PIP
(ID 921)
PIP
(ID 922)
PIP
(ID 923)
PIP
(ID 924)
PIP
(ID 925)
PIP
(ID 926)
PIP
(ID 927)
PIP
(ID 928)
PIP
(ID 929)
PIP
(ID 930)
PIP
(ID 931)
PIP
(ID 932)
PIP
(ID 933)
PIP
(ID 934)
PIP
(ID 935)
PIP
(ID 936)
PIP
(ID 937)
PIP
(ID 938)
PIP
(ID 939)
PIP
(ID 940)
PIP
(ID 941)
PIP
(ID 942)
PIP
(ID 943)
PIP
(ID 944)
PIP
(ID 945)
PIP
(ID 946)
PIP
(ID 947)
PIP
(ID 948)
PIP
(ID 949)
PIP
(ID 950)
PIP
(ID 951)
PIP
(ID 952)
PIP
(ID 953)
PIP
(ID 954)
PIP
(ID 955)
PIP
(ID 956)
PIP
(ID 957)
PIP
(ID 958)
PIP
(ID 959)
PIP
(ID 960)
PIP
(ID 961)
PIP
(ID 962)
PIP
(ID 963)
PIP
(ID 964)
PIP
(ID 965)
PIP
(ID 966)
PIP
(ID 967)
PIP
(ID 968)
PIP
(ID 969)
PIP
(ID 970)
PIP
(ID 971)
PIP
(ID 972)
PIP
(ID 973)
PIP
(ID 974)
PIP
(ID 975)
PIP
(ID 976)
PIP
(ID 977)
PIP
(ID 978)
PIP
(ID 979)
PIP
(ID 980)
PIP
(ID 981)
PIP
(ID 982)
PIP
(ID 983)
PIP
(ID 984)
PIP
(ID 985)
PIP
(ID 986)
PIP
(ID 987)
PIP
(ID 988)
PIP
(ID 989)
PIP
(ID 990)
PIP
(ID 991)
PIP
(ID 992)
PIP
(ID 993)
PIP
(ID 994)
PIP
(ID 995)
PIP
(ID 996)
PIP
(ID 997)
PIP
(ID 998)
PIP
(ID 999)
PIP
(ID 1000)
PIP
(ID 1001)
PIP
(ID 1002)
PIP
(ID 1003)
PIP
(ID 1004)
PIP
(ID 1005)
PIP
(ID 1006)
PIP
(ID 1007)
PIP
(ID 1008)
PIP
(ID 1009)
PIP
(ID 1010)
PIP
(ID 1011)
PIP
(ID 1012)
PIP
(ID 1013)
PIP
(ID 1014)
PIP
(ID 1015)
PIP
(ID 1016)
PIP
(ID 1017)
PIP
(ID 1018)
PIP
(ID 1019)
PIP
(ID 1020)
PIP
(ID 1021)
PIP
(ID 1022)
PIP
(ID 1023)
PIP
(ID 1024)
PIP
(ID 1025)
PIP
(ID 1026)
PIP
(ID 1027)
PIP
(ID 1028)
PIP
(ID 1029)
PIP
(ID 1030)
PIP
(ID 1031)
PIP
(ID 1032)
PIP
(ID 1033)
PIP
(ID 1034)
PIP
(ID 1035)
PIP
(ID 1036)
PIP
(ID 1037)
PIP
(ID 1038)
PIP
(ID 1039)
PIP
(ID 1040)
PIP
(ID 1041)
PIP
(ID 1042)
PIP
(ID 1043)
PIP
(ID 1044)
PIP
(ID 1045)
PIP
(ID 1046)
PIP
(ID 1047)
PIP
(ID 1048)
PIP
(ID 1049)
PIP
(ID 1050)
PIP
(ID 1051)
PIP
(ID 1052)
PIP
(ID 1053)
PIP
(ID 1054)
PIP
(ID 1055)
PIP
(ID 1056)
PIP
(ID 1057)
PIP
(ID 1058)
PIP
(ID 1059)
PIP
(ID 1060)
PIP
(ID 1061)
PIP
(ID 1062)
PIP
(ID 1063)
PIP
(ID 1064)
PIP
(ID 1065)
PIP
(ID 1066)
PIP
(ID 1067)
PIP
(ID 1068)
PIP
(ID 1069)
PIP
(ID 1070)
PIP
(ID 1071)
PIP
(ID 1072)
PIP
(ID 1073)
PIP
(ID 1074)
PIP
(ID 1075)
PIP
(ID 1076)
PIP
(ID 1077)
PIP
(ID 1078)
PIP
(ID 1079)
PIP
(ID 1080)
PIP
(ID 1081)
PIP
(ID 1082)
PIP
(ID 1083)
PIP
(ID 1084)
PIP
(ID 1085)
PIP
(ID 1086)
PIP
(ID 1087)
PIP
(ID 1088)
PIP
(ID 1089)
PIP
(ID 1090)
PIP
(ID 1091)
PIP
(ID 1092)
PIP
(ID 1093)
PIP
(ID 1094)
PIP
(ID 1095)
PIP
(ID 1096)
PIP
(ID 1097)
PIP
(ID 1098)
PIP
(ID 1099)
PIP
(ID 1100)
PIP
(ID 1101)
PIP
(ID 1102)
PIP
(ID 1103)
PIP
(ID 1104)
PIP
(ID 1105)
PIP
(ID 1106)
PIP
(ID 1107)
PIP
(ID 1108)
PIP
(ID 1109)
PIP
(ID 1110)
PIP
(ID 1111)
PIP
(ID 1112)
PIP
(ID 1113)
PIP
(ID 1114)
PIP
(ID 1115)
PIP
(ID 1116)
PIP
(ID 1117)
PIP
(ID 1118)
PIP
(ID 1119)
PIP
(ID 1120)
PIP
(ID 1121)
PIP
(ID 1122)
PIP
(ID 1123)
PIP
(ID 1124)
PIP
(ID 1125)
PIP
(ID 1126)
PIP
(ID 1127)
PIP
(ID 1128)
PIP
(ID 1129)
PIP
(ID 1130)
PIP
(ID 1131)
PIP
(ID 1132)
PIP
(ID 1133)
PIP
(ID 1134)
PIP
(ID 1135)
PIP
(ID 1136)
PIP
(ID 1137)
PIP
(ID 1138)
PIP
(ID 1139)
PIP
(ID 1140)
PIP
(ID 1141)
PIP
(ID 1142)
PIP
(ID 1143)
PIP
(ID 1144)
PIP
(ID 1145)
PIP
(ID 1146)
PIP
(ID 1147)
PIP
(ID 1148)
PIP
(ID 1149)
PIP
(ID 1150)
PIP
(ID 1151)
PIP
(ID 1152)
PIP
(ID 1153)
PIP
(ID 1154)
PIP
(ID 1155)
PIP
(ID 1156)
PIP
(ID 1157)
PIP
(ID 1158)
PIP
(ID 1159)
PIP
(ID 1160)
PIP
(ID 1161)
PIP
(ID 1162)
PIP
(ID 1163)
PIP
(ID 1164)
PIP
(ID 1165)
PIP
(ID 1166)
PIP
(ID 1167)
PIP
(ID 1168)
PIP
(ID 1169)
PIP
(ID 1170)
PIP
(ID 1171)
PIP
(ID 1172)
PIP
(ID 1173)
PIP
(ID 1174)
PIP
(ID 1175)
PIP
(ID 1176)
PIP
(ID 1177)
PIP
(ID 1178)
PIP
(ID 1179)
PIP
(ID 1180)
PIP
(ID 1181)
PIP
(ID 1182)
PIP
(ID 1183)
PIP
(ID 1184)
PIP
(ID 1185)
PIP
(ID 1186)
PIP
(ID 1187)
PIP
(ID 1188)
PIP
(ID 1189)
PIP
(ID 1190)
PIP
(ID 1191)
PIP
(ID 1192)
PIP
(ID 1193)
PIP
(ID 1194)
PIP
(ID 1195)
PIP
(ID 1196)
PIP
(ID 1197)
PIP
(ID 1198)
PIP
(ID 1199)
PIP
(ID 1200)
PIP
(ID 1201)
PIP
(ID 1202)
PIP
(ID 1203)
PIP
(ID 1204)
PIP
(ID 1205)
PIP
(ID 1206)
PIP
(ID 1207)
PIP
(ID 1208)
PIP
(ID 1209)
PIP
(ID 1210)
PIP
(ID 1211)
PIP
(ID 1212)
PIP
(ID 1213)
PIP
(ID 1214)
PIP
(ID 1215)
PIP
(ID 1216)
PIP
(ID 1217)
PIP
(ID 1218)
PIP
(ID 1219)
PIP
(ID 1220)
PIP
(ID 1221)
PIP
(ID 1222)
PIP
(ID 1223)
PIP
(ID 1224)
PIP
(ID 1225)
PIP
(ID 1226)
PIP
(ID 1227)
PIP
(ID 1228)
PIP
(ID 1229)
PIP
(ID 1230)
PIP
(ID 1231)
PIP
(ID 1232)
PIP
(ID 1233)
PIP
(ID 1234)
PIP
(ID 1235)
PIP
(ID 1236)
PIP
(ID 1237)
PIP
(ID 1238)
PIP
(ID 1239)
PIP
(ID 1240)
PIP
(ID 1241)
PIP
(ID 1242)
PIP
(ID 1243)
PIP
(ID 1244)
PIP
(ID 1245)
PIP
(ID 1246)
PIP
(ID 1247)
PIP
(ID 1248)
PIP
(ID 1249)
PIP
(ID 1250)
PIP
(ID 1251)
PIP
(ID 1252)
PIP
(ID 1253)
PIP
(ID 1254)
PIP
(ID 1255)
PIP
(ID 1256)
PIP
(ID 1257)
PIP
(ID 1258)
PIP
(ID 1259)
PIP
(ID 1260)
PIP
(ID 1261)
PIP
(ID 1262)
PIP
(ID 1263)
PIP
(ID 1264)
PIP
(ID 1265)
PIP
(ID 1266)
PIP
(ID 1267)
PIP
(ID 1268)
PIP
(ID 1269)
PIP
(ID 1270)
PIP
(ID 1271)
PIP
(ID 1272)
PIP
(ID 1273)
PIP
(ID 1275)
PIP
(ID 1276)
PIP
(ID 1277)
PIP
(ID 1278)
PIP
(ID 1279)
PIP
(ID 1280)
PIP
(ID 1281)
PIP
(ID 1282)
PIP
(ID 1283)
PIP
(ID 1284)
PIP
(ID 1285)
PIP
(ID 1286)
PIP
(ID 1287)
PIP
(ID 1288)
PIP
(ID 1289)
PIP
(ID 1290)
PIP
(ID 1291)
PIP
(ID 1292)
PIP
(ID 1293)
PIP
(ID 1294)
PIP
(ID 1295)
PIP
(ID 1296)
PIP
(ID 1297)
PIP
(ID 1298)
PIP
(ID 1299)
PIP
(ID 1300)
PIP
(ID 1301)
PIP
(ID 1302)
PIP
(ID 1303)
PIP
(ID 1304)
PIP
(ID 1305)
PIP
(ID 1306)
PIP
(ID 1307)
PIP
(ID 1308)
PIP
(ID 1309)
PIP
(ID 1310)
PIP
(ID 1311)
PIP
(ID 1312)
PIP
(ID 1313)
PIP
(ID 1314)
PIP
(ID 1315)
PIP
(ID 1316)
PIP
(ID 1317)
PIP
(ID 1318)
PIP
(ID 1319)
PIP
(ID 1320)
PIP
(ID 1321)
PIP
(ID 1322)
PIP
(ID 1323)
PIP
(ID 1324)
PIP
(ID 1325)
PIP
(ID 1326)
PIP
(ID 1327)
PIP
(ID 1328)
PIP
(ID 1329)
PIP
(ID 1330)
PIP
(ID 1331)
PIP
(ID 1332)
PIP
(ID 1333)
PIP
(ID 1334)
PIP
(ID 1335)
PIP
(ID 1336)
PIP
(ID 1337)
PIP
(ID 1338)
PIP
(ID 1339)
PIP
(ID 1340)
PIP
(ID 1341)
PIP
(ID 1342)
PIP
(ID 1343)
PIP
(ID 1344)
PIP
(ID 1345)
PIP
(ID 1346)
PIP
(ID 1347)
PIP
(ID 1348)
PIP
(ID 1349)
PIP
(ID 1350)
PIP
(ID 1351)
PIP
(ID 1352)
PIP
(ID 1353)
PIP
(ID 1354)
PIP
(ID 1355)
PIP
(ID 1356)
PIP
(ID 1357)
PIP
(ID 1358)
PIP
(ID 1359)
PIP
(ID 1360)
PIP
(ID 1361)
PIP
(ID 1362)
PIP
(ID 1363)
PIP
(ID 1364)
PIP
(ID 1365)
PIP
(ID 1366)
PIP
(ID 1367)
PIP
(ID 1368)
PIP
(ID 1369)
PIP
(ID 1370)
PIP
(ID 1371)
PIP
(ID 1372)
PIP
(ID 1373)
PIP
(ID 1374)
PIP
(ID 1375)
PIP
(ID 1376)
PIP
(ID 1377)
PIP
(ID 1378)
PIP
(ID 1379)
PIP
(ID 1380)
PIP
(ID 1381)
PIP
(ID 1382)
PIP
(ID 1383)
PIP
(ID 1384)
PIP
(ID 1385)
PIP
(ID 1386)
PIP
(ID 1387)
PIP
(ID 1388)
PIP
(ID 1389)
PIP
(ID 1390)
PIP
(ID 1391)
PIP
(ID 1392)
PIP
(ID 1393)
PIP
(ID 1394)
PIP
(ID 1395)
PIP
(ID 1396)
PIP
(ID 1397)
PIP
(ID 1398)
PIP
(ID 1399)
PIP
(ID 1400)
PIP
(ID 1401)
PIP
(ID 1402)
PIP
(ID 1403)
PIP
(ID 1404)
PIP
(ID 1405)
PIP
(ID 1406)
PIP
(ID 1407)
PIP
(ID 1408)
PIP
(ID 1409)
PIP
(ID 1410)
PIP
(ID 1411)
PIP
(ID 1412)
PIP
(ID 1413)
PIP
(ID 1414)
PIP
(ID 1415)
PIP
(ID 1416)
PIP
(ID 1417)
PIP
(ID 1418)
PIP
(ID 1419)
PIP
(ID 1420)
PIP
(ID 1421)
PIP
(ID 1422)
PIP
(ID 1423)
PIP
(ID 1424)
PIP
(ID 1425)
PIP
(ID 1426)
PIP
(ID 1427)
PIP
(ID 1428)
PIP
(ID 1429)
PIP
(ID 1430)
PIP
(ID 1431)
PIP
(ID 1432)
PIP
(ID 1433)
PIP
(ID 1434)
PIP
(ID 1435)
PIP
(ID 1436)
PIP
(ID 1437)
PIP
(ID 1438)
PIP
(ID 1439)
PIP
(ID 1440)
PIP
(ID 1441)
PIP
(ID 1442)
PIP
(ID 1443)
PIP
(ID 1444)
PIP
(ID 1445)
PIP
(ID 1446)
PIP
(ID 1447)
PIP
(ID 1448)
PIP
(ID 1449)
PIP
(ID 1450)
PIP
(ID 1452)
PIP
(ID 1453)
PIP
(ID 1454)
PIP
(ID 1455)
PIP
(ID 1456)
PIP
(ID 1457)
PIP
(ID 1458)
PIP
(ID 1459)
PIP
(ID 1460)
PIP
(ID 1461)
PIP
(ID 1462)
PIP
(ID 1463)
PIP
(ID 1464)
PIP
(ID 1465)
PIP
(ID 1466)
PIP
(ID 1467)
PIP
(ID 1468)
PIP
(ID 1469)
PIP
(ID 1470)
PIP
(ID 1471)
PIP
(ID 1472)
PIP
(ID 1473)
PIP
(ID 1474)
PIP
(ID 1475)
PIP
(ID 1476)
PIP
(ID 1477)
PIP
(ID 1478)
PIP
(ID 1479)
PIP
(ID 1480)
PIP
(ID 1481)
PIP
(ID 1482)
PIP
(ID 1483)
PIP
(ID 1484)
PIP
(ID 1485)
PIP
(ID 1486)
PIP
(ID 1487)
PIP
(ID 1488)
PIP
(ID 1489)
PIP
(ID 1490)
PIP
(ID 1491)
PIP
(ID 1492)
PIP
(ID 1493)
PIP
(ID 1494)
PIP
(ID 1495)
PIP
(ID 1496)
PIP
(ID 1497)
PIP
(ID 1498)
PIP
(ID 1499)
PIP
(ID 1500)
PIP
(ID 1501)
PIP
(ID 1502)
PIP
(ID 1503)
PIP
(ID 1504)
PIP
(ID 1505)
PIP
(ID 1506)
PIP
(ID 1507)
PIP
(ID 1508)
PIP
(ID 1509)
PIP
(ID 1510)
PIP
(ID 1511)
PIP
(ID 1513)
PIP
(ID 1514)
PIP
(ID 1515)
PIP
(ID 1516)
PIP
(ID 1517)
PIP
(ID 1518)
PIP
(ID 1519)
PIP
(ID 1520)
PIP
(ID 1521)
PIP
(ID 1522)
PIP
(ID 1523)
PIP
(ID 1524)
PIP
(ID 1525)
PIP
(ID 1526)
PIP
(ID 1527)
PIP
(ID 1528)
PIP
(ID 1529)
PIP
(ID 1530)
PIP
(ID 1531)
PIP
(ID 1532)
PIP
(ID 1533)
PIP
(ID 1534)
PIP
(ID 1535)
PIP
(ID 1536)
PIP
(ID 1537)
PIP
(ID 1538)
PIP
(ID 1539)
PIP
(ID 1540)
PIP
(ID 1541)
PIP
(ID 1542)
PIP
(ID 1543)
PIP
(ID 1544)
PIP
(ID 1545)
PIP
(ID 1546)
PIP
(ID 1547)
PIP
(ID 1548)
PIP
(ID 1549)
PIP
(ID 1550)
PIP
(ID 1551)
PIP
(ID 1552)
PIP
(ID 1553)
PIP
(ID 1554)
PIP
(ID 1555)
PIP
(ID 1556)
PIP
(ID 1557)
PIP
(ID 1558)
PIP
(ID 1559)
PIP
(ID 1560)
PIP
(ID 1561)
PIP
(ID 1562)
PIP
(ID 1563)
PIP
(ID 1564)
PIP
(ID 1565)
PIP
(ID 1566)
PIP
(ID 1567)
PIP
(ID 1568)
PIP
(ID 1569)
PIP
(ID 1570)
PIP
(ID 1571)
PIP
(ID 1572)
PIP
(ID 1573)
PIP
(ID 1574)
PIP
(ID 1575)
PIP
(ID 1576)
PIP
(ID 1577)
PIP
(ID 1578)
PIP
(ID 1579)
PIP
(ID 1580)
PIP
(ID 1581)
PIP
(ID 1582)
PIP
(ID 1583)
PIP
(ID 1584)
PIP
(ID 1585)
PIP
(ID 1586)
PIP
(ID 1587)
PIP
(ID 1588)
PIP
(ID 1589)
PIP
(ID 1590)
PIP
(ID 1591)
PIP
(ID 1592)
PIP
(ID 1593)
PIP
(ID 1594)
PIP
(ID 1595)
PIP
(ID 1596)
PIP
(ID 1597)
PIP
(ID 1598)
PIP
(ID 1599)
PIP
(ID 1600)
PIP
(ID 1601)
PIP
(ID 1602)
PIP
(ID 1603)
PIP
(ID 1604)
PIP
(ID 1605)
PIP
(ID 1606)
PIP
(ID 1607)
PIP
(ID 1608)
PIP
(ID 1609)
PIP
(ID 1610)
PIP
(ID 1611)
PIP
(ID 1612)
PIP
(ID 1613)
PIP
(ID 1614)
PIP
(ID 1615)
PIP
(ID 1616)
PIP
(ID 1617)
PIP
(ID 1618)
PIP
(ID 1619)
PIP
(ID 1620)
PIP
(ID 1621)
PIP
(ID 1622)
PIP
(ID 1623)
PIP
(ID 1624)
PIP
(ID 1625)
PIP
(ID 1626)
PIP
(ID 1627)
PIP
(ID 1628)
PIP
(ID 1629)
PIP
(ID 1630)
PIP
(ID 1631)
PIP
(ID 1632)
PIP
(ID 1633)
PIP
(ID 1634)
PIP
(ID 1635)
PIP
(ID 1636)
PIP
(ID 1637)
PIP
(ID 1638)
PIP
(ID 1639)
PIP
(ID 1640)
PIP
(ID 1641)
PIP
(ID 1642)
PIP
(ID 1643)
PIP
(ID 1644)
PIP
(ID 1645)
PIP
(ID 1646)
PIP
(ID 1647)
PIP
(ID 1648)
PIP
(ID 1649)
PIP
(ID 1650)
PIP
(ID 1651)
PIP
(ID 1652)
PIP
(ID 1653)
PIP
(ID 1654)
PIP
(ID 1655)
PIP
(ID 1656)
PIP
(ID 1657)
PIP
(ID 1658)
PIP
(ID 1659)
PIP
(ID 1660)
PIP
(ID 1661)
PIP
(ID 1662)
PIP
(ID 1663)
PIP
(ID 1664)
PIP
(ID 1665)
PIP
(ID 1666)
PIP
(ID 1667)
PIP
(ID 1668)
PIP
(ID 1669)
PIP
(ID 1670)
PIP
(ID 1671)
PIP
(ID 1672)
PIP
(ID 1673)
PIP
(ID 1674)
PIP
(ID 1675)
PIP
(ID 1676)
PIP
(ID 1677)
PIP
(ID 1678)
PIP
(ID 1679)
PIP
(ID 1680)
PIP
(ID 1681)
PIP
(ID 1682)
PIP
(ID 1683)
PIP
(ID 1684)
PIP
(ID 1685)
PIP
(ID 1686)
PIP
(ID 1687)
PIP
(ID 1688)
PIP
(ID 1689)
PIP
(ID 1690)
PIP
(ID 1691)
PIP
(ID 1692)
PIP
(ID 1693)
PIP
(ID 1694)
PIP
(ID 1695)
PIP
(ID 1696)
PIP
(ID 1697)
PIP
(ID 1698)
PIP
(ID 1699)
PIP
(ID 1700)
PIP
(ID 1701)
PIP
(ID 1702)
PIP
(ID 1703)
PIP
(ID 1704)
PIP
(ID 1705)
PIP
(ID 1706)
PIP
(ID 1707)
PIP
(ID 1708)
PIP
(ID 1709)
PIP
(ID 1710)
PIP
(ID 1711)
PIP
(ID 1712)
PIP
(ID 1713)
PIP
(ID 1714)
PIP
(ID 1715)
PIP
(ID 1716)
PIP
(ID 1717)
PIP
(ID 1718)
PIP
(ID 1719)
PIP
(ID 1720)
PIP
(ID 1721)
PIP
(ID 1722)
PIP
(ID 1723)
PIP
(ID 1724)
PIP
(ID 1725)
PIP
(ID 1726)
PIP
(ID 1727)
PIP
(ID 1728)
PIP
(ID 1729)
PIP
(ID 1730)
PIP
(ID 1731)
PIP
(ID 1732)
PIP
(ID 1733)
PIP
(ID 1734)
PIP
(ID 1735)
PIP
(ID 1736)
PIP
(ID 1737)
PIP
(ID 1738)
PIP
(ID 1739)
PIP
(ID 1740)
PIP
(ID 1741)
PIP
(ID 1742)
PIP
(ID 1743)
PIP
(ID 1744)
PIP
(ID 1745)
PIP
(ID 1746)
PIP
(ID 1747)
PIP
(ID 1748)
PIP
(ID 1749)
PIP
(ID 1751)
PIP
(ID 1752)
PIP
(ID 1753)
PIP
(ID 1754)
PIP
(ID 1755)
PIP
(ID 1756)
PIP
(ID 1757)
PIP
(ID 1758)
PIP
(ID 1759)
PIP
(ID 1760)
PIP
(ID 1761)
PIP
(ID 1762)
PIP
(ID 1763)
PIP
(ID 1764)
PIP
(ID 1765)
PIP
(ID 1766)
PIP
(ID 1767)
PIP
(ID 1768)
PIP
(ID 1769)
PIP
(ID 1770)
PIP
(ID 1771)
PIP
(ID 1772)
PIP
(ID 1773)
PIP
(ID 1774)
PIP
(ID 1775)
PIP
(ID 1776)
PIP
(ID 1777)
PIP
(ID 1778)
PIP
(ID 1779)
PIP
(ID 1780)
PIP
(ID 1781)
PIP
(ID 1782)
PIP
(ID 1783)
PIP
(ID 1784)
PIP
(ID 1785)
PIP
(ID 1786)
PIP
(ID 1787)
PIP
(ID 1788)
PIP
(ID 1789)
PIP
(ID 1790)
PIP
(ID 1791)
PIP
(ID 1792)
PIP
(ID 1793)
PIP
(ID 1794)
PIP
(ID 1795)
PIP
(ID 1796)
PIP
(ID 1797)
PIP
(ID 1798)
PIP
(ID 1799)
PIP
(ID 1800)
PIP
(ID 1801)
PIP
(ID 1802)
PIP
(ID 1803)
PIP
(ID 1804)
PIP
(ID 1805)
PIP
(ID 1806)
PIP
(ID 1807)
PIP
(ID 1808)
PIP
(ID 1809)
PIP
(ID 1810)
PIP
(ID 1811)
PIP
(ID 1812)
PIP
(ID 1813)
PIP
(ID 1814)
PIP
(ID 1816)
PIP
(ID 1817)
PIP
(ID 1818)
PIP
(ID 1819)
PIP
(ID 1820)
PIP
(ID 1821)
PIP
(ID 1822)
PIP
(ID 1823)
PIP
(ID 1824)
PIP
(ID 1825)
PIP
(ID 1826)
PIP
(ID 1827)
PIP
(ID 1828)
PIP
(ID 1829)
PIP
(ID 1830)
PIP
(ID 1831)
PIP
(ID 1832)
PIP
(ID 1833)
PIP
(ID 1834)
PIP
(ID 1835)
PIP
(ID 1836)
PIP
(ID 1837)
PIP
(ID 1838)
PIP
(ID 1839)
PIP
(ID 1840)
PIP
(ID 1841)
PIP
(ID 1842)
PIP
(ID 1843)
PIP
(ID 1844)
PIP
(ID 1845)
PIP
(ID 1846)
PIP
(ID 1847)
PIP
(ID 1848)
PIP
(ID 1849)
PIP
(ID 1850)
PIP
(ID 1851)
PIP
(ID 1852)
PIP
(ID 1853)
PIP
(ID 1854)
PIP
(ID 1855)
PIP
(ID 1856)
PIP
(ID 1857)
PIP
(ID 1858)
PIP
(ID 1859)
PIP
(ID 1860)
PIP
(ID 1863)
PIP
(ID 1864)
PIP
(ID 1865)
PIP
(ID 1866)
PIP
(ID 1867)
PIP
(ID 1868)
PIP
(ID 1869)
PIP
(ID 1870)
PIP
(ID 1871)
PIP
(ID 1872)
PIP
(ID 1873)
PIP
(ID 1874)
PIP
(ID 1875)
PIP
(ID 1876)
PIP
(ID 1877)
PIP
(ID 1878)
PIP
(ID 1879)
PIP
(ID 1880)
PIP
(ID 1881)
PIP
(ID 1882)
PIP
(ID 1883)
PIP
(ID 1884)
PIP
(ID 1885)
PIP
(ID 1886)
PIP
(ID 1887)
PIP
(ID 1888)
PIP
(ID 1889)
PIP
(ID 1890)
PIP
(ID 1891)
PIP
(ID 1892)
PIP
(ID 1901)
PIP
(ID 1902)
PIP
(ID 1903)
PIP
(ID 1904)
PIP
(ID 1905)
PIP
(ID 1906)
PIP
(ID 1907)
PIP
(ID 1908)
PIP
(ID 1909)
PIP
(ID 1910)
PIP
(ID 1911)
PIP
(ID 1912)
PIP
(ID 1913)
PIP
(ID 1914)
PIP
(ID 1915)
PIP
(ID 1916)
PIP
(ID 1917)
PIP
(ID 1918)
PIP
(ID 1919)
PIP
(ID 1920)
PIP
(ID 1921)
PIP
(ID 1922)
PIP
(ID 1923)
PIP
(ID 1924)
PIP
(ID 1925)
PIP
(ID 1926)
PIP
(ID 1927)
PIP
(ID 1928)
PIP
(ID 1929)
PIP
(ID 1930)
PIP
(ID 1931)
PIP
(ID 1932)
PIP
(ID 1933)
PIP
(ID 1934)
PIP
(ID 1938)
PIP
(ID 1939)
PIP
(ID 1940)
PIP
(ID 1941)
PIP
(ID 1942)
PIP
(ID 1943)
PIP
(ID 1944)
PIP
(ID 1945)
PIP
(ID 1946)
PIP
(ID 1947)
PIP
(ID 1948)
PIP
(ID 1949)
PIP
(ID 1950)
PIP
(ID 1951)
PIP
(ID 1952)
PIP
(ID 1953)
PIP
(ID 1954)
PIP
(ID 1955)
PIP
(ID 1956)
PIP
(ID 1957)
PIP
(ID 1958)
PIP
(ID 1959)
PIP
(ID 1960)
PIP
(ID 1961)
PIP
(ID 1962)
PIP
(ID 1963)
PIP
(ID 1964)
PIP
(ID 1965)
PIP
(ID 1966)
PIP
(ID 1967)
PIP
(ID 1968)
PIP
(ID 1969)
PIP
(ID 1970)
PIP
(ID 1971)
PIP
(ID 1972)
PIP
(ID 1973)
PIP
(ID 1974)
PIP
(ID 1975)
PIP
(ID 1977)
PIP
(ID 1978)
PIP
(ID 1979)
PIP
(ID 1980)
PIP
(ID 1981)
PIP
(ID 1982)
PIP
(ID 1983)
PIP
(ID 1984)
PIP
(ID 1985)
PIP
(ID 1986)
PIP
(ID 1987)
PIP
(ID 1988)
PIP
(ID 1989)
PIP
(ID 1990)
PIP
(ID 1991)
PIP
(ID 1992)
PIP
(ID 1993)
PIP
(ID 1994)
PIP
(ID 1995)
PIP
(ID 1996)
PIP
(ID 1997)
PIP
(ID 1998)
PIP
(ID 1999)
PIP
(ID 2000)
PIP
(ID 2001)
PIP
(ID 2002)
PIP
(ID 2003)
PIP
(ID 2004)
PIP
(ID 2005)
PIP
(ID 2006)
PIP
(ID 2007)
PIP
(ID 2008)
PIP
(ID 2009)
PIP
(ID 2010)
PIP
(ID 2011)
PIP
(ID 2012)
PIP
(ID 2013)
PIP
(ID 2014)
PIP
(ID 2015)
PIP
(ID 2016)
PIP
(ID 2017)
PIP
(ID 2018)
PIP
(ID 2019)
PIP
(ID 2020)
PIP
(ID 2021)
PIP
(ID 2022)
PIP
(ID 2023)
PIP
(ID 2024)
PIP
(ID 2025)
PIP
(ID 2026)
PIP
(ID 2027)
PIP
(ID 2028)
PIP
(ID 2029)
PIP
(ID 2030)
PIP
(ID 2031)
PIP
(ID 2032)
PIP
(ID 2033)
PIP
(ID 2034)
PIP
(ID 2035)
PIP
(ID 2036)
PIP
(ID 2037)
PIP
(ID 2038)
PIP
(ID 2039)
PIP
(ID 2040)
PIP
(ID 2042)
PIP
(ID 2043)
PIP
(ID 2050)
PIP
(ID 2052)
PIP
(ID 2053)
PIP
(ID 2054)
PIP
(ID 2055)
PIP
(ID 2056)
PIP
(ID 2057)
PIP
(ID 2058)
PIP
(ID 2059)
PIP
(ID 2060)
PIP
(ID 2061)
PIP
(ID 2062)
PIP
(ID 2063)
PIP
(ID 2064)
PIP
(ID 2065)
PIP
(ID 2066)
PIP
(ID 2067)
PIP
(ID 2068)
PIP
(ID 2069)
PIP
(ID 2072)
PIP
(ID 2073)
PIP
(ID 2074)
PIP
(ID 2075)
PIP
(ID 2076)
PIP
(ID 2077)
PIP
(ID 2078)
PIP
(ID 2079)
PIP
(ID 2080)
PIP
(ID 2081)
PIP
(ID 2082)
PIP
(ID 2083)
PIP
(ID 2084)
PIP
(ID 2085)
PIP
(ID 2086)
PIP
(ID 2087)
PIP
(ID 2088)
PIP
(ID 2089)
PIP
(ID 2090)
PIP
(ID 2091)
PIP
(ID 2092)
PIP
(ID 2093)
PIP
(ID 2094)
PIP
(ID 2095)
PIP
(ID 2096)
PIP
(ID 2097)
PIP
(ID 2098)
PIP
(ID 2099)
PIP
(ID 2100)
PIP
(ID 2101)
PIP
(ID 2102)
PIP
(ID 2103)
PIP
(ID 2104)
PIP
(ID 2105)
PIP
(ID 2106)
PIP
(ID 2107)
PIP
(ID 2108)
PIP
(ID 2109)
PIP
(ID 2109)
PIP
(ID 2110)
PIP
(ID 2110)
PIP
(ID 2111)
PIP
(ID 2111)
PIP
(ID 2112)
PIP
(ID 2112)
PIP
(ID 2113)
PIP
(ID 2113)
PIP
(ID 2114)
PIP
(ID 2115)
PIP
(ID 2116)
PIP
(ID 2117)
PIP
(ID 2118)
PIP
(ID 2119)
PIP
(ID 2120)
PIP
(ID 2121)
PIP
(ID 2122)
PIP
(ID 2123)
PIP
(ID 2124)
PIP
(ID 2125)
PIP
(ID 2126)
PIP
(ID 2127)
PIP
(ID 2128)
PIP
(ID 2129)
PIP
(ID 2130)
PIP
(ID 2131)
PIP
(ID 2132)
PIP
(ID 2133)
PIP
(ID 2134)
PIP
(ID 2135)
PIP
(ID 2136)
PIP
(ID 2137)
PIP
(ID 2138)
PIP
(ID 2139)
PIP
(ID 2140)
PIP
(ID 2141)
PIP
(ID 2142)
PIP
(ID 2143)
PIP
(ID 2144)
PIP
(ID 2145)
PIP
(ID 2146)
PIP
(ID 2147)
PIP
(ID 2148)
PIP
(ID 2149)
PIP
(ID 2150)
PIP
(ID 2151)
PIP
(ID 2152)
PIP
(ID 2153)
PIP
(ID 2154)
PIP
(ID 2155)
PIP
(ID 2156)
PIP
(ID 2157)
PIP
(ID 2158)
PIP
(ID 2159)
PIP
(ID 2160)
PIP
(ID 2161)
PIP
(ID 2162)
PIP
(ID 2163)
PIP
(ID 2164)
PIP
(ID 2165)
PIP
(ID 2166)
PIP
(ID 2167)
PIP
(ID 2168)
PIP
(ID 2169)
PIP
(ID 2170)
PIP
(ID 2171)
PIP
(ID 2172)
PIP
(ID 2173)
PIP
(ID 2174)
PIP
(ID 2175)
PIP
(ID 2176)
PIP
(ID 2177)
PIP
(ID 2178)
PIP
(ID 2179)
PIP
(ID 2180)
PIP
(ID 2181)
PIP
(ID 2182)
PIP
(ID 2183)
PIP
(ID 2184)
PIP
(ID 2185)
PIP
(ID 2186)
PIP
(ID 2187)
PIP
(ID 2188)
PIP
(ID 2189)
PIP
(ID 2190)
PIP
(ID 2191)
PIP
(ID 2192)
PIP
(ID 2193)
PIP
(ID 2223)
PIP
(ID 2229)
PIP
(ID 2230)
PIP
(ID 2231)
PIP
(ID 2232)
PIP
(ID 2233)
PIP
(ID 2234)
PIP
(ID 2235)
PIP
(ID 2236)
PIP
(ID 2237)
PIP
(ID 2238)
PIP
Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter
Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter
Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter
Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter
Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter
Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter
Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter
Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter
Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter
Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter
Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter
Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter
Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter
Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter
Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter
Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter
Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter
Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter
Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter
Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter
Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter
Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter
Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter
Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter
Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter
Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter
Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter
Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter
Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter
Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter
Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter
Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter
Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter
Stadtgrenze
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 14); Länge: 28 Meter
Doppelmauer (ID: 15); Länge: 357 Meter
Doppelmauer (ID: 16); Länge: 65 Meter
Doppelmauer (ID: 17); Länge: 121 Meter
Doppelmauer (ID: 18); Länge: 104 Meter
Doppelmauer (ID: 19); Länge: 62 Meter
Doppelmauer (ID: 20); Länge: 35 Meter
Doppelmauer (ID: 21); Länge: 24 Meter
Doppelmauer (ID: 22); Länge: 38 Meter
Doppelmauer (ID: 23); Länge: 31 Meter
Doppelmauer (ID: 24); Länge: 6 Meter
Doppelmauer (ID: 25); Länge: 24 Meter
Doppelmauer (ID: 26); Länge: 74 Meter
Doppelmauer (ID: 27); Länge: 122 Meter
Doppelmauer (ID: 28); Länge: 240 Meter
Doppelmauer (ID: 29); Länge: 98 Meter
Doppelmauer (ID: 30); Länge: 20 Meter
Doppelmauer (ID: 31); Länge: 9 Meter
Doppelmauer (ID: 32); Länge: 6 Meter
Doppelmauer (ID: 33); Länge: 587 Meter
Doppelmauer (ID: 34); Länge: 146 Meter
Doppelmauer (ID: 35); Länge: 169 Meter
Doppelmauer (ID: 36); Länge: 54 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 37); Länge: 34 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 38); Länge: 55 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 39); Länge: 31 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 40); Länge: 28 Meter
einfache Mauer / Stadtgrenze (ID: 41); Länge: 103 Meter
Turm I
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm II
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm III
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm IV
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm V
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm VI
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm VII
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm VIII
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm IX
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm X
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm XI
Externe Links
PIP
Kommentar
Turm XII
Externe Links
PIP
Kommentar
Kartierung der Gebäudeeingänge und Gebäudeflächen. Die einzelnen Marker sind klickbar. Im sich öffnenden Info-Window befindet sich jeweils ein Link auf die korrespondierende Seite von https://pompeiiinpictures.com.
2.6. Höhen
Messpunkt: 26.6 m über NN
Messpunkt: 32.8 m über NN
Messpunkt: 34.9 m über NN
Messpunkt: 33.1 m über NN
Messpunkt: 33.2 m über NN
Messpunkt: 32.9 m über NN
Messpunkt: 34.1 m über NN
Messpunkt: 32.6 m über NN
Messpunkt: 33.8 m über NN
Messpunkt: 33.7 m über NN
Messpunkt: 34.2 m über NN
Messpunkt: 34.1 m über NN
Messpunkt: 34.3 m über NN
Messpunkt: 34.6 m über NN
Messpunkt: 34.5 m über NN
Messpunkt: 33.9 m über NN
Messpunkt: 32.7 m über NN
Messpunkt: 32.9 m über NN
Messpunkt: 31.5 m über NN
Messpunkt: 31.9 m über NN
Messpunkt: 32.0 m über NN
Messpunkt: 26.4 m über NN
Messpunkt: 22.8 m über NN
Messpunkt: 25.2 m über NN
Messpunkt: 29.9 m über NN
Messpunkt: 32.4 m über NN
Messpunkt: 18.0 m über NN
Messpunkt: 15.0 m über NN
Messpunkt: 25.0 m über NN
Messpunkt: 23.2 m über NN
Messpunkt: 12.0 m über NN
Messpunkt: 33.4 m über NN
Messpunkt: 33.2 m über NN
Messpunkt: 30.6 m über NN
Messpunkt: 28.3 m über NN
Messpunkt: 28.0 m über NN
Messpunkt: 28.0 m über NN
Messpunkt: 25.4 m über NN
Messpunkt: 26.4 m über NN
Messpunkt: 24.3 m über NN
Messpunkt: 30.1 m über NN
Messpunkt: 31.6 m über NN
Messpunkt: 33.2 m über NN
Messpunkt: 32.5 m über NN
Messpunkt: 33.2 m über NN
Messpunkt: 14.1 m über NN
Messpunkt: 16.0 m über NN
Messpunkt: 14.0 m über NN
Messpunkt: 11.5 m über NN
Messpunkt: 24.1 m über NN
Messpunkt: 25.1 m über NN
Messpunkt: 27.3 m über NN
Messpunkt: 25.1 m über NN
Messpunkt: 24.6 m über NN
Messpunkt: 24.9 m über NN
Messpunkt: 20.5 m über NN
Messpunkt: 16.4 m über NN
Messpunkt: 13.3 m über NN
Messpunkt: 11.2 m über NN
Messpunkt: 9.1 m über NN
Messpunkt: 11.0 m über NN
Messpunkt: 29.5 m über NN
Messpunkt: 28.0 m über NN
Messpunkt: 27.4 m über NN
Messpunkt: 28.4 m über NN
Messpunkt: 31.0 m über NN
Messpunkt: 29.9 m über NN
Messpunkt: 34.7 m über NN
Messpunkt: 34.7 m über NN
Messpunkt: 38.0 m über NN
Messpunkt: 39.9 m über NN
Messpunkt: 38.7 m über NN
Messpunkt: 42.5 m über NN
Messpunkt: 41.8 m über NN
Messpunkt: 42.9 m über NN
Messpunkt: 41.8 m über NN
Messpunkt: 39.8 m über NN
Messpunkt: 39.8 m über NN
Messpunkt: 40.7 m über NN
Messpunkt: 42.5 m über NN
Messpunkt: 39.2 m über NN
Messpunkt: 42.0 m über NN
Messpunkt: 39.5 m über NN
Messpunkt: 42.0 m über NN
Messpunkt: 42.6 m über NN
Messpunkt: 32.2 m über NN
Messpunkt: 35.7 m über NN
Messpunkt: 34.9 m über NN
Messpunkt: 37.2 m über NN
Messpunkt: 35.2 m über NN
Messpunkt: 37.9 m über NN
Messpunkt: 36.5 m über NN
Messpunkt: 34.3 m über NN
Messpunkt: 34.6 m über NN
Messpunkt: 35.2 m über NN
Messpunkt: 37.5 m über NN
Messpunkt: 34.5 m über NN
Messpunkt: 33.5 m über NN
Messpunkt: 33.0 m über NN
Messpunkt: 32.7 m über NN
Messpunkt: 32.5 m über NN
Messpunkt: 23.0 m über NN
Messpunkt: 33.6 m über NN
Messpunkt: 27.3 m über NN
Messpunkt: 33.7 m über NN
Messpunkt: 33.6 m über NN
Messpunkt: 29.0 m über NN
Messpunkt: 29.0 m über NN
Messpunkt: 30.5 m über NN
Messpunkt: 32.0 m über NN
Messpunkt: 31.6 m über NN
Messpunkt: 30.3 m über NN
Messpunkt: 30.9 m über NN
Messpunkt: 32.9 m über NN
Messpunkt: 33.2 m über NN
Messpunkt: 33.8 m über NN
Messpunkt: 35.3 m über NN
Messpunkt: 35.7 m über NN
Messpunkt: 31.2 m über NN
Messpunkt: 31.8 m über NN
Messpunkt: 31.0 m über NN
Messpunkt: 35.2 m über NN
Messpunkt: 33.4 m über NN
Messpunkt: 35.0 m über NN
Messpunkt: 28.2 m über NN
Messpunkt: 27.0 m über NN
Messpunkt: 26.4 m über NN
Messpunkt: 25.7 m über NN
Messpunkt: 19.7 m über NN
Messpunkt: 24.6 m über NN
Messpunkt: 19.3 m über NN
Messpunkt: 21.2 m über NN
Messpunkt: 20.9 m über NN
Messpunkt: 21.0 m über NN
Messpunkt: 13.0 m über NN
Messpunkt: 25.3 m über NN
Messpunkt: 18.3 m über NN
Messpunkt: 18.7 m über NN
Messpunkt: 16.8 m über NN
Messpunkt: 20.1 m über NN
Messpunkt: 20.3 m über NN
Messpunkt: 20.8 m über NN
Messpunkt: 21.4 m über NN
Messpunkt: 22.2 m über NN
Messpunkt: 20.9 m über NN
Messpunkt: 20.8 m über NN
Messpunkt: 21.4 m über NN
Messpunkt: 20.6 m über NN
Messpunkt: 20.2 m über NN
Messpunkt: 22.5 m über NN
Messpunkt: 22.4 m über NN
Messpunkt: 22.7 m über NN
Messpunkt: 23.0 m über NN
Messpunkt: 23.3 m über NN
Messpunkt: 18.4 m über NN
Messpunkt: 15.2 m über NN
Messpunkt: 13.6 m über NN
Messpunkt: 10.6 m über NN
Messpunkt: 18.5 m über NN
Messpunkt: 25.1 m über NN
Messpunkt: 26.1 m über NN
Messpunkt: 24.6 m über NN
Messpunkt: 24.2 m über NN
Messpunkt: 23.7 m über NN
Messpunkt: 23.7 m über NN
Messpunkt: 28.1 m über NN
Messpunkt: 27.0 m über NN
Messpunkt: 22.3 m über NN
Messpunkt: 20.5 m über NN
Messpunkt: 20.0 m über NN
Messpunkt: 19.6 m über NN
Messpunkt: 14.8 m über NN
Messpunkt: 14.0 m über NN
Messpunkt: 31.5 m über NN
Messpunkt: 33.0 m über NN
Messpunkt: 26.2 m über NN
Messpunkt: 32.4 m über NN
Messpunkt: 21.0 m über NN
Messpunkt: 25.0 m über NN
Messpunkt: 37.6 m über NN
Messpunkt: 36.0 m über NN
Messpunkt: 39.9 m über NN
Messpunkt: 43.9 m über NN
Messpunkt: 44.1 m über NN
Messpunkt: 49.5 m über NN
Messpunkt: 40.0 m über NN
Messpunkt: 42.1 m über NN
Messpunkt: 35.6 m über NN
Messpunkt: 37.7 m über NN
Messpunkt: 38.2 m über NN
Messpunkt: 34.2 m über NN
Messpunkt: 33.3 m über NN
Messpunkt: 33.6 m über NN
Messpunkt: 30.9 m über NN
Messpunkt: 30.9 m über NN
Messpunkt: 30.9 m über NN
Messpunkt: 33.3 m über NN
Messpunkt: 33.8 m über NN
Messpunkt: 36.2 m über NN
Messpunkt: 35.3 m über NN
Messpunkt: 33.9 m über NN
Messpunkt: 29.4 m über NN
Messpunkt: 30.2 m über NN
Messpunkt: 30.5 m über NN
Messpunkt: 29.9 m über NN
Messpunkt: 22.5 m über NN
Messpunkt: 22.3 m über NN
Messpunkt: 23.7 m über NN
Messpunkt: 19.0 m über NN
Messpunkt: 25.5 m über NN
Messpunkt: 9.5 m über NN
Messpunkt: 38.6 m über NN
Messpunkt: 40.7 m über NN
Messpunkt: 48.0 m über NN
Messpunkt: 42.3 m über NN
Messpunkt: 36.0 m über NN
Messpunkt: 36.8 m über NN
Messpunkt: 38.0 m über NN
Messpunkt: 36.2 m über NN
Messpunkt: 34.0 m über NN
Messpunkt: 33.9 m über NN
Messpunkt: 31.7 m über NN
Messpunkt: 29.8 m über NN
Messpunkt: 30.0 m über NN
Messpunkt: 28.4 m über NN
Messpunkt: 26.0 m über NN
Messpunkt: 26.6 m über NN
Messpunkt: 23.4 m über NN
Messpunkt: 26.5 m über NN
Messpunkt: 25.4 m über NN
Messpunkt: 31.2 m über NN
Messpunkt: 27.3 m über NN
Messpunkt: 30.2 m über NN
Messpunkt: 30.3 m über NN
Messpunkt: 33.0 m über NN
Messpunkt: 30.4 m über NN
Messpunkt: 26.6 m über NN
Messpunkt: 25.2 m über NN
Messpunkt: 26.3 m über NN
Messpunkt: 19.0 m über NN
Messpunkt: 33.3 m über NN
Messpunkt: 38.4 m über NN
Messpunkt: 42.1 m über NN
Messpunkt: 37.7 m über NN
Messpunkt: 36.4 m über NN
Messpunkt: 36.2 m über NN
Messpunkt: 36.4 m über NN
Messpunkt: 33.7 m über NN
Messpunkt: 33.6 m über NN
Messpunkt: 12.6 m über NN
Messpunkt: 34.6 m über NN
Messpunkt: 14.1 m über NN
26.6 m über NN
32.8 m über NN
34.9 m über NN
33.1 m über NN
33.2 m über NN
32.9 m über NN
34.1 m über NN
32.6 m über NN
33.8 m über NN
33.7 m über NN
34.2 m über NN
34.1 m über NN
34.3 m über NN
34.6 m über NN
34.5 m über NN
33.9 m über NN
32.7 m über NN
32.9 m über NN
31.5 m über NN
31.9 m über NN
32.0 m über NN
26.4 m über NN
22.8 m über NN
25.2 m über NN
29.9 m über NN
32.4 m über NN
18.0 m über NN
15.0 m über NN
25.0 m über NN
23.2 m über NN
12.0 m über NN
33.4 m über NN
33.2 m über NN
30.6 m über NN
28.3 m über NN
28.0 m über NN
28.0 m über NN
25.4 m über NN
26.4 m über NN
24.3 m über NN
30.1 m über NN
31.6 m über NN
33.2 m über NN
32.5 m über NN
33.2 m über NN
14.1 m über NN
16.0 m über NN
14.0 m über NN
11.5 m über NN
24.1 m über NN
25.1 m über NN
27.3 m über NN
25.1 m über NN
24.6 m über NN
24.9 m über NN
20.5 m über NN
16.4 m über NN
13.3 m über NN
11.2 m über NN
9.1 m über NN
11.0 m über NN
29.5 m über NN
28.0 m über NN
27.4 m über NN
28.4 m über NN
31.0 m über NN
29.9 m über NN
34.7 m über NN
34.7 m über NN
38.0 m über NN
39.9 m über NN
38.7 m über NN
42.5 m über NN
41.8 m über NN
42.9 m über NN
41.8 m über NN
39.8 m über NN
39.8 m über NN
40.7 m über NN
42.5 m über NN
39.2 m über NN
42.0 m über NN
39.5 m über NN
42.0 m über NN
42.6 m über NN
32.2 m über NN
35.7 m über NN
34.9 m über NN
37.2 m über NN
35.2 m über NN
37.9 m über NN
36.5 m über NN
34.3 m über NN
34.6 m über NN
35.2 m über NN
37.5 m über NN
34.5 m über NN
33.5 m über NN
33.0 m über NN
32.7 m über NN
32.5 m über NN
23.0 m über NN
33.6 m über NN
27.3 m über NN
33.7 m über NN
33.6 m über NN
29.0 m über NN
29.0 m über NN
30.5 m über NN
32.0 m über NN
31.6 m über NN
30.3 m über NN
30.9 m über NN
32.9 m über NN
33.2 m über NN
33.8 m über NN
35.3 m über NN
35.7 m über NN
31.2 m über NN
31.8 m über NN
31.0 m über NN
35.2 m über NN
33.4 m über NN
35.0 m über NN
28.2 m über NN
27.0 m über NN
26.4 m über NN
25.7 m über NN
19.7 m über NN
24.6 m über NN
19.3 m über NN
21.2 m über NN
20.9 m über NN
21.0 m über NN
13.0 m über NN
25.3 m über NN
18.3 m über NN
18.7 m über NN
16.8 m über NN
20.1 m über NN
20.3 m über NN
20.8 m über NN
21.4 m über NN
22.2 m über NN
20.9 m über NN
20.8 m über NN
21.4 m über NN
20.6 m über NN
20.2 m über NN
22.5 m über NN
22.4 m über NN
22.7 m über NN
23.0 m über NN
23.3 m über NN
18.4 m über NN
15.2 m über NN
13.6 m über NN
10.6 m über NN
18.5 m über NN
25.1 m über NN
26.1 m über NN
24.6 m über NN
24.2 m über NN
23.7 m über NN
23.7 m über NN
28.1 m über NN
27.0 m über NN
22.3 m über NN
20.5 m über NN
20.0 m über NN
19.6 m über NN
14.8 m über NN
14.0 m über NN
31.5 m über NN
33.0 m über NN
26.2 m über NN
32.4 m über NN
21.0 m über NN
25.0 m über NN
37.6 m über NN
36.0 m über NN
39.9 m über NN
43.9 m über NN
44.1 m über NN
49.5 m über NN
40.0 m über NN
42.1 m über NN
35.6 m über NN
37.7 m über NN
38.2 m über NN
34.2 m über NN
33.3 m über NN
33.6 m über NN
30.9 m über NN
30.9 m über NN
30.9 m über NN
33.3 m über NN
33.8 m über NN
36.2 m über NN
35.3 m über NN
33.9 m über NN
29.4 m über NN
30.2 m über NN
30.5 m über NN
29.9 m über NN
22.5 m über NN
22.3 m über NN
23.7 m über NN
19.0 m über NN
25.5 m über NN
9.5 m über NN
38.6 m über NN
40.7 m über NN
48.0 m über NN
42.3 m über NN
36.0 m über NN
36.8 m über NN
38.0 m über NN
36.2 m über NN
34.0 m über NN
33.9 m über NN
31.7 m über NN
29.8 m über NN
30.0 m über NN
28.4 m über NN
26.0 m über NN
26.6 m über NN
23.4 m über NN
26.5 m über NN
25.4 m über NN
31.2 m über NN
27.3 m über NN
30.2 m über NN
30.3 m über NN
33.0 m über NN
30.4 m über NN
26.6 m über NN
25.2 m über NN
26.3 m über NN
19.0 m über NN
33.3 m über NN
38.4 m über NN
42.1 m über NN
37.7 m über NN
36.4 m über NN
36.2 m über NN
36.4 m über NN
33.7 m über NN
33.6 m über NN
12.6 m über NN
34.6 m über NN
14.1 m über NN
Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter
Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter
Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter
Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter
Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter
Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter
Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter
Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter
Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter
Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter
Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter
Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter
Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter
Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter
Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter
Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter
Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter
Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter
Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter
Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter
Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter
Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter
Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter
Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter
Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter
Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter
Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter
Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter
Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter
Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter
Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter
Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter
Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter
Stadtgrenze
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
[markerGroup load="pompeji_laufbrunnen"]
[linestringGroup load="pompeji_planquadrate_100"]
Die kleinen Punkte auf der Karte sind die Vermessungspunkte, die auf der Karte von Müller-Trollius eingetragen sind. Die die Vermessungspunkte umgebenden Polygone wurden mit dem Voronoi-Algorithmus des Programms QGIS erzeugt, anschließend im WKT-Format in eine CSV-Datei exportiert und diese dann wieder in die Datenbank importiert.
Die Karte visualisiert, basierend auf den 252 Vermessungspunkten, die auf der Karte von Müller-Trollius eingetragen sind, das Geländerelief von Pompeji. Der älteste Teil der Stadt liegt auf der Spitze eines nicht besonders ausgeprägten Höhenzugs, der sich vom Südabhang des Vesuvs in Richtung Süden hin zum Fluss Sarno erstreckt. Vermutlich handelt es sich um einen alten Lavastrom. Der Sporn des Höhenzugs, auf dem der älteste Teil Pompejis liegt, fällt in Richtung Süden und Westen steil ab. Gut sichtbar wird dies in Darstellungen digitaler Geländemodelle (z. B. <https://de-de.topographic-map.com/map-3r92s8/Pompei/?zoom=15¢er=40.7507%2C14.49161>; TessaDEM near-global 30-meter Digital Elevation Model [(DEM]; s. auch Abb. 5###). Der höchste Punkt des Stadtgebiets liegt mit 49,5 Metern unweit der Porta del Vesuvio am Nordende des Cardo maximus (Via del Vesuvio). Nicht zufällig liegt genau dort das Castellum Aquae, von dem aus die ganze Stadt mit Frischwasser versorgt wurde. Genau am anderen, südlichen, Ende des Cardo Maximus befindet sich, am Stabianer Tor, mit 9,5 Metern der tiefste Punkt im Bereich des Stadtgebiets von Pompeji. Zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt im Stadtgebiet von Pompeji liegt also eine Höhendifferenz von ziemlich genau 40 Metern, die in gerader Linie über den Cardo Maximus der Stadt miteinander verbunden sind. Auffällig im Muster der Voronoi-Polygone ist die "Mulde" im Bereich des Amphitheaters: Dessen Arena liegt mit 13 Metern rund 5 Meter niedriger als das Bodenniveau des umliegenden Terrains.
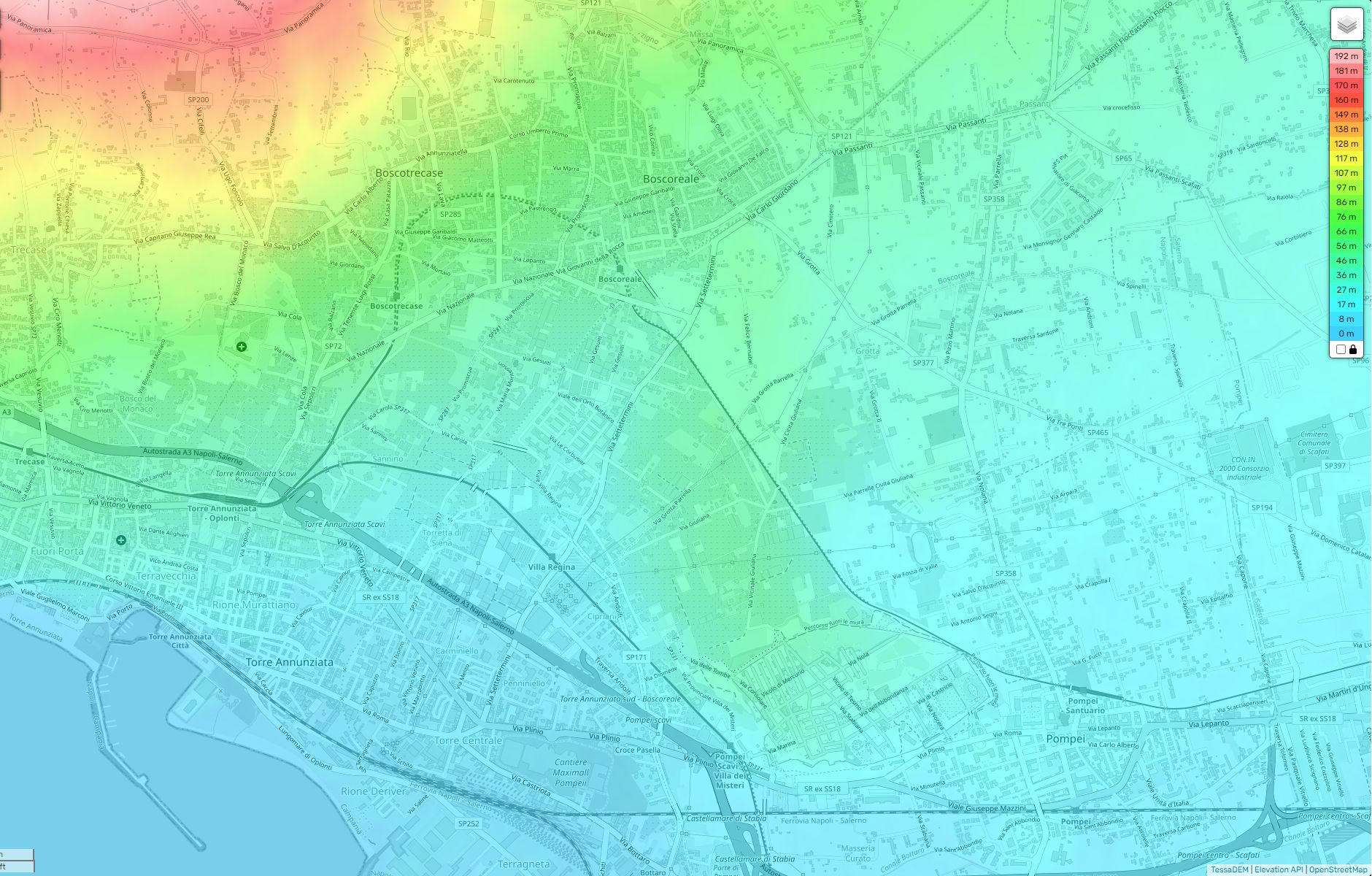
Quelle: https://topographic-map.com/ (Screenshot von <https://de-de.topographic-map.com/map-3r92s8/Pompei/?zoom=15¢er=40.7507%2C14.49161>; TessaDEM near-global 30-meter Digital Elevation Model [DEM]. Erlaubnis zur Verwendung in online-Publikation gegeben von guillaume.vk@tessanet.fr per Mail an luecke@lmu.de am 2024-06-11).
3. Wasserversorgung
Der Wasserversorgung Pompejis diente ein Abzweig des sog. Serino-Aquaeducts (= Aqua Augusta).9 Dieser Aquaeduct, der vermutlich unter Kaiser Augustus angelegt worden ist, hatte seinen Ausgangspunkt bei dem etwa 40 Kilometer nordöstlich von Pompeji gelegenen Serino und führte von dort grosso modo nach Westen bis nach Misenum. Neben Pompeji versorgte er, teils wie Pomepeji über weitere Seitenäste, u.a. Sarno, Nola, Herculaneum, Neapel, Pozzuoli und Cumae mit Wasser.10.
In Pompeji trat der Aquaeduct am höchstgelegenen Punkt des Stadtgebiets in den ummauerten Bereich. Dort befindet sich auf einer Höhe von etwa 43 Metern über NN das Castellum aquae (auch: Castellum divisorium). Von dort wurde das Wasser über insgesamt drei Hauptleitungen im Stadtgebiet verteilt. Der öffentlichen Wasserversorgung dienten in der Fläche einigermaßen gleichmäßig verteilte Laufbrunnen, von denen bislang rund 40 ausgegraben worden sind.
[markerGroup load="pompeji_hoehen_punkte"]
[markerGroup load="pompeji_voronoi_label"]
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 1
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 2
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 3
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 4
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 5
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 6
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 7
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 8
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 9
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 10
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 11
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 12
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 13
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 14
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 15
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 16
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 17
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 18
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 19
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 20
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 21
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 22
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 23
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 24
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 25
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 26
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 27
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 29
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 30
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 31
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 32
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 33
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 34
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 35
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 36
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 37
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 38
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 39
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 40
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 41
Einzugsbereich Laufbrunnen: ID 43
Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter
Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter
Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter
Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter
Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter
Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter
Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter
Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter
Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter
Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter
Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter
Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter
Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter
Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter
Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter
Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter
Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter
Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter
Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter
Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter
Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter
Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter
Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter
Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter
Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter
Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter
Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter
Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter
Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter
Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter
Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter
Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter
Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter
Stadtgrenze
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
Laufbrunnen vor Eingang zwischen II 1, 2 und II 1, 3 (ID 1)
Laufbrunnen vor Eingang VI 1, 19 (ID 2)
Laufbrunnen vor Eingang VI 3, 20 (ID 3)
Laufbrunnen vor Eingang VI 8, 24 (ID 4)
Laufbrunnen vor Eingang VI 13, 7 (ID 5)
Laufbrunnen vor Eingang VI 13, 7 (ID 6)
Laufbrunnen vor Eingang VI 14, 17a (ID 7)
Laufbrunnen vor Eingang VI 16, 4 (ID 8)
Laufbrunnen vor Eingang VI 16, 19 (ID 9)
Laufbrunnen vor Eingang VII 4, 32 (ID 10)
Laufbrunnen vor Eingang VII 9, 67 (ID 11)
Laufbrunnen vor Eingang VII 14, 13 (ID 12)
Laufbrunnen vor Eingang VIII 2, 29 (ID 13)
Laufbrunnen vor Eingang zwischen VIII 3, 31 und VIII 2, 11 (ID 14)
Laufbrunnen vor Eingang VIII 7, 30 (ID 15)
Laufbrunnen vor Eingang IX 7, 17 (ID 16)
Laufbrunnen vor Eingang IX 8, 1 (ID 17)
Laufbrunnen vor Eingang IX 10, 2 (ID 18)
Laufbrunnen vor Eingang IX 11, 1 (ID 19)
Laufbrunnen vor Eingang I 4, 15 (ID 20)
Laufbrunnen vor Eingang I 5, 2 (ID 21)
Laufbrunnen vor Eingang I 9, 1 (ID 22)
Laufbrunnen vor Eingang I 10, 1 (ID 23)
Laufbrunnen vor Eingang I 12, 2 (ID 24)
Laufbrunnen vor Eingang I 13, 10 (ID 25)
Laufbrunnen vor Eingang I 16, 4 (ID 26)
Laufbrunnen vor Eingang II 3, 5 (ID 27)
Laufbrunnen vor Eingang VIII 2, 20 (ID 29)
Laufbrunnen vor Eingang VII 15, 1 (ID 30)
Laufbrunnen vor Eingang VII 1, 32 (ID 31)
Laufbrunnen vor Eingang VII 7, 26 (ID 32)
Laufbrunnen vor Eingang VII 11, 5 (ID 33)
Laufbrunnen vor Eingang SO der Insula VIII 7 (ID 34)
Laufbrunnen vor Eingang VIII 7, 25 (ID 35)
Laufbrunnen vor Eingang VII 15, 12 (ID 36)
Laufbrunnen vor Eingang VI 16, 28 (ID 37)
Laufbrunnen vor Eingang III 11, 1 (ID 38)
Laufbrunnen vor Eingang V 1, 3 (ID 39)
Laufbrunnen vor Eingang Nordost-Zugang zum Forum (ID 40)
Laufbrunnen vor Eingang Nordende des Forum Triangulare (ID 41)
Laufbrunnen vor Eingang Eingebaut in sog. Bogen des Caligula (vor VI 10, 10). Vgl. Olsson 2015, S. 19. (ID 43)
Der Regelung des Wasserdrucks dienten die, gleichfalls halbwegs gleichmäßig im Stadtgebiet verteilten, Wassertürme, von denen bislang insgesamt 14 bekannt sind. Ohne diese Wassertürme wäre an den verschiedenen Laufbrunnen jeweils unterschiedlicher Wasserdruck angestanden. Da sich in einem System geschlossener Röhren pro zehn Metern Höhenunterschied ein Druck von einem Bar aufbaut, würde, ohne die zwischengeschalteten Wassertürme, am tiefstgelegenen Laufbrunnen (9,1 m Höhe über NN; direkt an der Porta di Stabia gelegen) ein Wasserdruck von über vier Bar anstehen. Bei höher gelegenen Laufbrunnen wäre der anstehende Wasserdruck ohne die zwischengeschalteten Wassertürme entsprechend niedriger.11
Die Höhenlage der Laufbrunnen und Wassertürme wurde auf Basis von mit QGIS erzeugten Voronoi-Polygonen um die auf der Eschebach-Karte eingetragenen Höhenmesspunkte ermittelt. Zu diesem Zweck wurde mit der MySQL-Funktion st_intersects() festgestellt, innerhalb welches Voronoi-Polygons sich jeweils die Punktkoordinaten eines Laufbrunnens oder eines Wasserturms befinden. Die Höhe des geometrischen Mittelpunkts des jeweiligen Voronoi Polygons (= Messpunkt auf der Eschebach-Karte) wurde dann als Höhenangabe auf die Brunnen bzw. Türme übertragen. Die entsprechenden Höhenangaben sind demnach als Näherungswerte mit einer geschätzten Unschärfe von im Schnitt weniger als einem Höhenmeter zu verstehen.
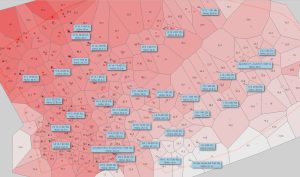
QGIS-Karte. Die Polygone wurden mit Hilfe des Voronoi-Algorithmus um die, gleichfarbig dargestellten, Messpunkte mit der Höhe über NN erzeugt. Blaue Punkte markieren die Lage der Laufbrunnen, deren Höhenangabe auf Basis der Lage innerhalb des jeweils korrespondierenden Voronoi-Polygons errechnet wurde.
Die Wassertürme regulierten den Wasserdruck in der Weise, dass das zugeführte Wasser zunächst über eine Druckleitung in einen Behälter auf der Spitze des Turmes geführt wurde. Zumindest ein Exemplar dieser Behälter ist bei den Ausgrabungen gefunden, jedoch anscheinend während eines der Bombenangriffe im Jahr 1943 zerstört worden. Der Behälter war aus Blei gefertigt und fasste bei einer Grundfläche von 0,65 m x 0,65 m und einer Höhe von 0,56 m maximal 237 Liter Wasser.
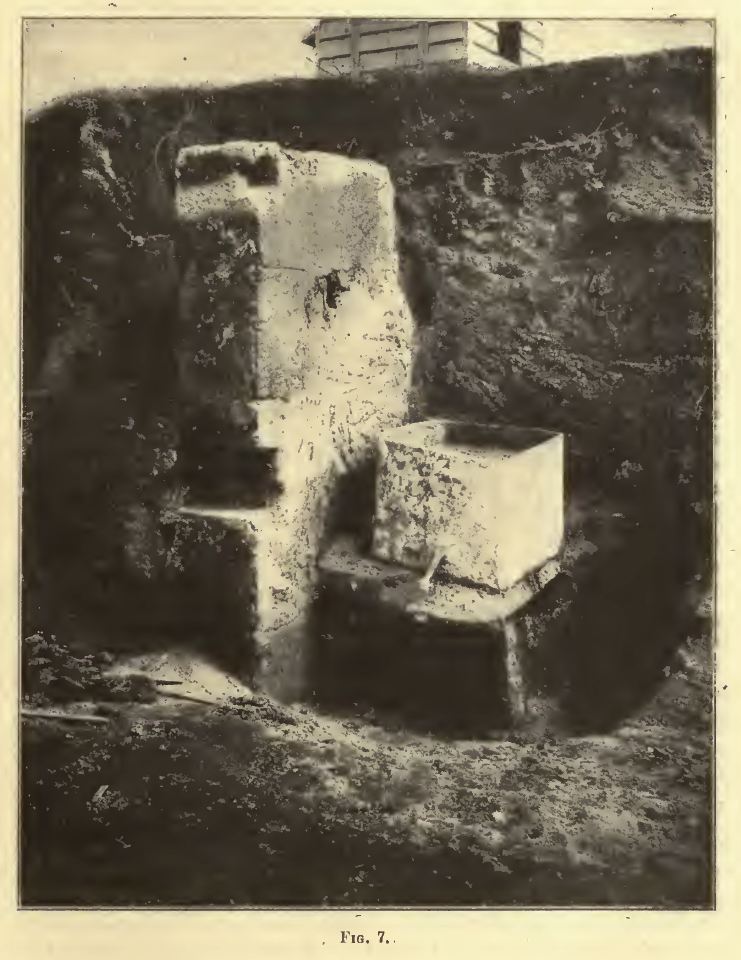
Wasserturm samt bleiernem Wasserbehälter. Ursprünglich an der Nordwestecke von Insula II 5 gefunden, bei einem Bombenangriff 1943 zerstört. (Abb.Spinazzola, V. (1917). Regione I (Latium e Campania). Notizie degli scavi di antichità, 1917, 247–264, hier: 255 Abb. 7 [pdf]).
Die Wasserbehälter besaßen offenbar keine Abdeckung, was die Gefahr von Verunreinigung des Wasser durch Tiere oder Witterung barg. Der potentielle Druck an den jeweils von einem Wasserturm versorgten Laufbrunnen errechnet sich aus der Differenz zwischen der Höhe des Wasserturmbehälters und der des Auslaufs am Laufbrunnen. Die Wassertürme waren zwischen sechs und acht Metern hoch (Schram, Romanaquaeducts).
Zusätzlich zu den öffentlichen Laufbrunnen besaßen viele Gebäude in Pompeji direkte Hausanschlüsse. Innerhalb der Gebäude wurde das Wasser dann über interne Leitungssysteme weiter verteilt (s. Jansen 1996; u. a. nachgewiesen in den Gebäuden VII 2, 44.45 [Casa dell'Orso], VIII 4, 14.15.16.22.23.30 [Casa di C. Cornelius Rufus] und VI 15, 1.27 [Casa dei Vettii].). Ebenso wie die Behälter auf den Wassertürmen waren die manche Komponenten der Leitungssysteme, namentlich die Verteilerkästen, aus Blei gefertigt.12 Eigene Hausanschlüsse dürften, neben den großen Atriumhäusern der Wohlhabenden, vor allem auch Werkstätten mit hohem Wasserbedarf wie z. B. Gerbereien13 und Fullonicae (zahlreiche über das Stadtgebiet verteilt) gehabt haben.
Die Laufbrunnen sind sicher täglicher Treffpunkt von Personen gewesen, die in ihrem Einzugsbereich gewohnt oder gearbeitet haben. Sehr wahrscheinlich dürfte es sich dabei um die eher 'einfachen' Leute gehandelt haben, deren Wohnung oder Werkstätte keinen eigenen Wasseranschluss hatte. Auch Bedienstete der Wohlhabenden kann man sich als mehr oder minder regelmäßige Besucher der öffentlichen Laufbrunnen vorstellen. Die begüterte Oberschicht hingegen wird man eher selten dort gesehen haben. Für einen bestimmten Personenkreis waren die Laufbrunnen jedenfalls regelmäßiger Treffpunkt. Der Einzugsbereich eines Laufbrunnens kann insofern als eine Art 'Mikroregion' betrachtet werden, deren Bewohner eine kleine soziale Gemeinschaft bildeten.
Die Gebäude der jeweiligen Mikroregionen lassen sich ermitteln, indem man die Flächen der Gebäude sich mit den Voronoi-Polygonen um die Punktkoordinaten der Laufbrunnen schneiden lässt. Die entsprechende Operation lässt sich wiederum mit der MySQL-Funktion st_intersect() durchführen. Die Voronoi-Polygone um die Punktkoordinaten der Laufbrunnen herum sind wiederum durch den entsprechenden QGIS-Algorithmus erzeugt und dann in die Datenbank übertragen worden.
/* SQL-Statement zur Ermittlung der Zugehörigkeit der Gebäude zum Einzugsbereich der Laufbrunnen */ SELECT group_concat(b.id_brunnen) IDs_Brunnen, a.gebaeude FROM gebaeude a JOIN brunnen b ON ST_INTERSECTS(a.wkb_flaeche,b.wkb_voronoi) where b.kategorie LIKE 'Laufbrunnen' GROUP BY gebaeude ORDER BY b.id_brunnen ;

Lage der Gebäude im Einzugsbereich umliegender Laufbrunnen. Einzelne Gebäude können auch im Einzugsgebiet mehrerer Laufbrunnen liegen.
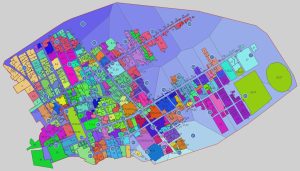
Gleichfarbige Gebäudeflächen markieren Zugehörigkeit zu einer Brunnengemeinschaft. Die auf den Flächen angegebenen Zahlen identifizieren die jeweiligen Brunnen, die den Gebäuden am nächsten liegen. Diese IDs sind datenbankspezifisch. Die Nummern in den weiß umrandeten Kreisen sind die datenbankinternen IDs der Laufbrunnen. Sie stehen jeweils in der geometrischen Mitte der sie umgebendem, in Blautönen dargestellten Voronoi-Polygone im Hintergrund. Deren Farbsättigung korrespondiert mit der Höhe der Laufbrunnen über NN. Die Karte wurde mit dem Programm QGIS erzeugt.
3.1. Gebäudenutzung
Via Stabiana (Maximus); Länge: 485 Meter
Via di Nola (Hauptstraße); Länge: 448 Meter
Vico delle Nozze d'Argento (Nebenstraße); Länge: 112 Meter
Via delle Terme (Hauptstraße); Länge: 102 Meter
Via della Fortuna (Hauptstraße); Länge: 189 Meter
Via dell'Abbondanza (Maximus); Länge: 869 Meter
Via Marina (Maximus); Länge: 156 Meter
Via di Castricio (Nebenstraße); Länge: 370 Meter
Via di Balbo (Nebenstraße); Länge: 62 Meter
Vico del Panettiere (Nebenstraße); Länge: 87 Meter
Via del tempio d'Iside (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
Vico della parete rossa (Nebenstraße); Länge: 105 Meter
Via della Regina (Nebenstraße); Länge: 161 Meter
Vico dei Scheletri (Nebenstraße); Länge: 151 Meter
Via del Vesuvio (Maximus); Länge: 240 Meter
Vicolo di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 278 Meter
Vicolo di Menandro (Nebenstraße); Länge: 127 Meter
Vicolo del Balcone Pensile (Nebenstraße); Länge: 148 Meter
Via degli Augustali (Nebenstraße); Länge: 225 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
Vicolo dei Soprastanti (Nebenstraße); Länge: 147 Meter
Vicolo del Gallo (Nebenstraße); Länge: 110 Meter
Vicolo di Championnet (Nebenstraße); Länge: 71 Meter
Vicolo del Conciapelle (Nebenstraße); Länge: 61 Meter
Via Nocera (Hauptstraße); Länge: 270 Meter
Via consolare (Hauptstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Narciso (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Modesto (Nebenstraße); Länge: 224 Meter
Vicolo della fullonica (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
Via di Mercurio (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Fauno (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo del Labirinto (Nebenstraße); Länge: 234 Meter
Vicolo dei Vetti (Nebenstraße); Länge: 220 Meter
Vicolo di Cecilio Giocondo (Nebenstraße); Länge: 95 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 169 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 159 Meter
Vicolo del Gigante (Nebenstraße); Länge: 81 Meter
Via del Foro (Nebenstraße); Länge: 411 Meter
Vicolo di Eumachia (Nebenstraße); Länge: 125 Meter
Vicolo del Lupanare (Nebenstraße); Länge: 123 Meter
Via delle Scuole (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
Vicolo dei 12 Dei (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Via dei Teatri (Nebenstraße); Länge: 109 Meter
Vicolo del Citarista (Nebenstraße); Länge: 244 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo del Farmacista (Nebenstraße); Länge: 121 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 183 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 91 Meter
Vicolo della Venere (Nebenstraße); Länge: 90 Meter
Vicolo di Giulia Felice (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo dell'Anfiteatro (Nebenstraße); Länge: 89 Meter
Via delle Tombe (Hauptstraße); Länge: 250 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 266 Meter
Via della Palestra (Nebenstraße); Länge: 185 Meter
Vicolo Storto (Nebenstraße); Länge: 97 Meter
Vicolo delle Terme (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
Vicolo di Tesmo (Nebenstraße); Länge: 242 Meter
Vicolo della Maschera (Nebenstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 119 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 444 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 89 Meter
Vicolo di Paquius Proculus (Nebenstraße); Länge: 170 Meter
Vicolo del Efebo (Nebenstraße); Länge: 158 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 238 Meter
Vicolo della Nave Europa (Nebenstraße); Länge: 239 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 237 Meter
Vicolo dei Fuggiaschi (Nebenstraße); Länge: 240 Meter
Vicolo di Octavius Quartio (Nebenstraße); Länge: 236 Meter
Vicolo di Ifigenia (Hauptstraße); Länge: 120 Meter
Vicolo di Lucrezio Frontone (Hauptstraße); Länge: 34 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 122 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 153 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 129 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 100 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 70 Meter
NN (Hauptstraße); Länge: 43 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 42 Meter
Vicolo dei Gladiatori (Nebenstraße); Länge: 106 Meter
Vicolo del Centenario (Nebenstraße); Länge: 65 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 146 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 130 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 116 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 172 Meter
NN (Nebenstraße); Länge: 167 Meter
Stadtgrenze
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
Bäckerei: V 1, 14.15.16 (Fläche: 211 qm)
Eschebach 1993: "Großes Haus mit Bäckerei (pistor dulciarius, Herstellung von liba und placenta) und hospitium (?)."
Bäckerei: V 3, 8 (Fläche: 343 qm)
Eschebach 1993: "Bäckerei."
Bäckerei: V 4, 1.2 (Fläche: 321 qm)
Eschebach 1993: "Bäckerei."
Bäckerei: VI 2, 6 (Fläche: 99 qm)
Eschebach 1993: "Bäckerei zum Haus des A. Cossius Libanus"
Bäckerei: VI 3, 3.27.28 (Fläche: 385 qm)
Eschebach 1993: "Casa del Forno, Bäckerei."
Bäckerei: VI 5, 15 (Fläche: 163 qm)
Eschebach 1993: "Bäckerei eines pistor dulciarius und Lebensmittelgeschäft (?), hospitium (?)"
Bäckerei: VI 6, 4.5 (Fläche: 64 qm)
Eschebach 1993: "Kleine Bäckerei. Kleines Haus eines pistor dulciarius (Verkauf von Opferkuchen?); Haus des P. Cipio?"
Bäckerei: VI 6, 17.18.19.20.21 (Fläche: 200 qm)
Eschebach 1993: "Miet-Bäckerei mit Laden und Wohnungen im OG."
Bäckerei: VI 14, 33.34 (Fläche: 256 qm)
Eschebach 1993: "79 n. Chr. stillgelegte Bäckerei."
Bäckerei: VII 1, 36.37 (Fläche: 338 qm)
Eschebach 1993: "Pistrinum des Lucius und des Q. Granius Verus, Großbäckerei. Casa del Panettiere, mit Bäckerladen."
Bäckerei: VII 2, 22 (Fläche: 196 qm)
Eschebach 1993: "Eckhaus mit großer Süßwarenbäckerei des M. Fabius Lalus."
Bäckerei: VII 4, 29 (Fläche: 149 qm)
Eschebach 1993: "Bäckerei, Laden und posticum zu 57."
Bäckerei: VII 4, 57.29 (Fläche: 884 qm)
Eschebach 1993: "Casa dei Capitelli figurati; Casa dei Capitelli dei Satiri. Im Peristyl 57 officina textoria, im Nebenhaus 29 Süßwarenbäckerei mit Laden?"
Bäckerei: VII 6, 26.27 (Fläche: 77 qm)
Eschebach 1993: "Popina mit Bäckerladen des C. Marcellus?"
Bäckerei: VII 12, 11 (Fläche: 172 qm)
Eschebach 1993: "Geschäftshaus mit Laden; Casa del Forno; ehemalige Großbäckerei. Erdbebengrundstück eines pistrinum, 79 n. Chr. im Neubau oder in Umwandlung begriffen."
Bäckerei: I 4, 12.13.14.15.16.17 (Fläche: 341 qm)
Eschebach 1993: "Großbetrieb mit Bäckereien und Läden des D. Junius Proculus (Magonius?), nicht verbunden mit den Häusern 5,25, aber vermutlich von deren Besitzern (Getreide- und Weinproduzenten) gepachtet."
4. Test
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Erste Erweiterungsphase
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Siedlungskern
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Zweite Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Dritte Erweiterungsphase
Stadtgrenze
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Q1
R1
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2
H2
I2
J2
K2
L2
M2
N2
O2
P2
Q2
R2
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3
H3
I3
J3
K3
L3
M3
N3
O3
P3
Q3
R3
A4
B4
C4
D4
E4
F4
G4
H4
I4
J4
K4
L4
M4
N4
O4
P4
Q4
R4
A5
B5
C5
D5
E5
F5
G5
H5
I5
J5
K5
L5
M5
N5
O5
P5
Q5
R5
A6
B6
C6
D6
E6
F6
G6
H6
I6
J6
K6
L6
M6
N6
O6
P6
Q6
R6
A7
B7
C7
D7
E7
F7
G7
H7
I7
J7
K7
L7
M7
N7
O7
P7
Q7
R7
A8
B8
C8
D8
E8
F8
G8
H8
I8
J8
K8
L8
M8
N8
O8
P8
Q8
R8
A9
B9
C9
D9
E9
F9
G9
H9
I9
J9
K9
L9
M9
N9
O9
P9
Q9
R9
Porta Ercolana
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta del Vesuvio
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Capua
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nola
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Sarno
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Nocera
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta di Stabia
Externe Links
PIP
Kommentar
Porta Marina
Externe Links
PIP
Kommentar
Bibliographie
- Eschebach 1993 = Eschebach, Hans / Müller-Trollius, Jürgen (1993): Gebäudeverzeichnis und Stadtplan der antiken Stadt Pompeji, Köln [u.a.], Böhlau, 500, ISBN: 3412037915.
- Hodge 1992 = Hodge, A. Trevor (1992): Roman aqueducts & water supply, London : Duckworth, ISBN: 978-0-7156-2194-3 (Link).
- Hunink 2022 = Hunink, VJC (22022): Glücklich ist dieser Ort! 1000 Graffiti aus Pompeji, eingeleitet, besorgt, und übersetzt von Vincent Hunink, Stuttgart, Reclam [Publisher: Stuttgart: Reclam Verlag].
- Jansen 1996 = Jansen, Gemma (1996): Die Verteilung des Leitungswassers in den Häusern Pompejis, in: N. de Haan/G. Jansen (eds) Cura Aquarum in Campania, Proceedings of the 9th International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Leiden, 47-50.
- Lücke 2018 = Lücke, Stephan (2018): Tabula Peutingeriana, in: Methodologie, VerbaAlpina-de 18/2 (Link).
- McConnell/Chellman/Plach u.a. 2025 = McConnell, Joseph R. / Chellman, Nathan J. / Plach, Andreas / Wensman, Sophia M. / Plunkett, Gill / Stohl, Andreas / Smith, Nicole-Kristine / Møllesøe Vinther, Bo / Dahl-Jensen, Dorthe / Steffensen, Jørgen Peder / Fritzsche, Diedrich / Camara-Brugger, Sandra O. / McDonald, Brandon T. / Wilson, Andrew I. (2025): Pan-European atmospheric lead pollution, enhanced blood lead levels, and cognitive decline from Roman-era mining and smelting, in: Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 122, 3, e2419630121 [Publisher: Proceedings of the National Academy of Sciences] (Link).
- Olsson 2015 = Olsson, Richard (2015): The water-supply system in Roman Pompeii, Lund [Licentiate Thesis, Classical archaeology and ancient history] (Link).
- PIP = Dunn, Jackie / Dunn, Bob (2011-): PompeiiinPictures (Link).
- Poehler 2013 = Poehler, Eric (2013): Pompeii bibliography and mapping project (Link).
- Poehler 2017 = Poehler, Eric (2017): A New Map for Pompeii (Link).
- Sample 2025 = Sample, Ian (2025): Roman Empire’s use of lead lowered IQ levels across Europe, study finds, in: The Guardian (Link).
- Wikipedia 2024 = Wikipedia-Autoren (2024): Pompeji, in: Wikipedia [Page Version ID: 244761403] (Link).